- Oh, Lord, wo steht Ihnen eigentlich das Wasser?
(S. 81)
„Am Freitag vor Pfingsten, kurz vor Arbeitsschluß, rief Arthur Thiele die Abteilungsleiter der Firmen Chemnitzer Zähne und Fin Star zu sich: Benedikt Stierle, der Konkurrent, hatte aufgegeben, er hatte seine Firma und sich in Brand gesteckt. Die Abteilungsleiter erhoben sich, Thiele dankte, die Sitzung war beendet, frohe Pfingsten. Franz Horn war als erster an der Tür.
Die Zeiten, als Thiele nach einem solchen Ereignis unbedingt noch ein paar Sätze mit Franz Horn wechseln mußte, waren vollkommen vorbei. Auch Dr. Liszt, der Kollege und Freund, war nicht mehr an einem Gespräch mit Horn interessiert, das sah er deutlich, denn Liszt eilte, wie alle anderen, auf Thiele zu.
Vor ein paar Jahren hatte Franz Horn einen Selbstmord versucht. Da er nicht gelang, wurde er zu Horns Mißerfolgen gezählt: Horns Zeit war vorüber, er gehörte zu den rapid Älterwerdenden; eine junge Mannschaft rückte heran, eine Fusion mit der Weltfirma Bayer stand bevor. Die Tatsache, daß auch Liszt, der von seiner Familie Verlassene und dem Alkohol Ergebene, in diesen neuen Zeiten keine Chance mehr hatte, war ohne Trost für ihn; Liszt weigerte sich, sein Verbündeter zu sein. Ja, es hatte den Anschein, als sei er ein Feind geworden, zumindest aber einer, mit dem er in Feindseligkeit leben mußte.
Warum nicht einen Brief schreiben, einen richtigen Brief, einen langsam geschriebenen Brief, in dem er Liszt den historischen Anteil an der Krise ihrer Beziehung oder Freundschaft zuweisen konnte? Damit endlich einmal alles richtig ausgesprochen wäre. Damit man wieder atmen, die Freundschaft neu oder endgültig begründen könnte. Lieber Lord Liszt! (Die Anrede war da, als Horn nach dem Schreiber griff.) Und Franz Horn begann zu schreiben., Seite um Seite. Und beendete den Brief. Und nahm ihn mit einem PS wieder auf. Und dem ersten PS folgte ein zweites, ein drittes, ein viertes; am Ende waren es neunzehn Fortsetzungen.
Was aber enthält der Brief, der in der Art der Lawinenentstehung ins Nichtgeheuere oder Ungeheuere anschwillt und – wie Lawinen es tun – alles, was im Weg liegt, mitreißt, aus den Höhen in die Tiefe oder aus den Tiefen in die Höhe, das Unausgesprochene, Nur-Empfundene? Was er Liszt vorzuwerfen hat, sind keine strafbaren Delikte, die sich trefflich in Szene setzen ließen. Es geht um Kränkungen, Verletzungen, Niederlagen, Unrecht menschlicher Art. Zwischen Liszt und Horn, Horn und Liszt, zwischen Thiele und Horn und Liszt. Es geht um Konkurrenz, um Anerkennungs-, Freundschafts- und Liebesentzug, um das gefahrvolle Leben, wenn genommen wird, was stark und widerstandsfähig macht; es geht um die Überwindung eines Zustands permanenten Verschweigens, um das plötzliche Aufbrechen eines Schmerzes, der artikuliert werden will, ohne Rücksicht auf die anderen und auf sich selbst.
Das Schreiben wird ein Ersatz für alles: ‚Sprechen wir doch endlich aus, soviel wir können, anstatt zu leiden wie die Hummeln. Oder leiden Sie gar nicht? Leidet, wer recht hat, nicht?’
Nicht in den einzelnen Fällen minutiöser und gröblicher Verletzung durch den anderen wird der Leser sich und seine Erfahrungen wiederfinden. Vielmehr wird sich der Leser im Faktum des Verletztwerdens erkennen, im wahnwitzigen Wunsch, sich all dessen zu erledigen, was ihn der zu sein zwingt, der er nicht ist. Der Leser wird sich an die von anderen eigens für ihn erdachte weise Erkenntnis erinnern: ‚Jeder sieht ein, daß er einsehen muß: ihm steht nur zu, was ihm zusteht.’ Und er wird sich endlich entledigen wollen, ‚nicht mehr der Vernunft anderer zu Kreuze zu kriechen’.
Das Buch ist ein Abrechnungsfest, ein Befreiungsunternehmen, eine Trennungsorgie, eine Wahrheitsmaschine, eine Einsamkeitsprüfung, kurzum: der Bericht von der schweren Erträglichkeit des wirklichen Lebens. Also eine Schmerzensgeschichte und ein Heilungsprozeß. Dieser rücksichtslos leidenschaftliche Brief ist nicht weniger als ein Lehrbuch: Es zeigt uns einen Weg, um (wieder) in den Besitz der eigenen Vernunft zu kommen.“
(aus dem Klappentext)
Der Roman Brief an Lord Liszt von Martin Walser (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1. Auflage 1982) ist die Fortsetzung des ebenso kleinen Romans Jenseits der Liebe aus dem Jahr 1976.
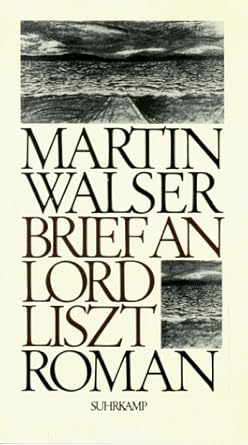
Im Mittelpunkt des Romans von Martin Walser steht wieder Franz Horn, der sich diesmal entschließt, seinem Konkurrenten in der Firma, Dr. Horst Liszt, Leiter der Verwaltung, einen Brief zu schreiben. Zuvor hatte er sich um eine Anstellung bei Benedikt Stierle bemüht. Dieser hatte nun sich und seine Firma in Brand gesteckt. Das bedeutete für Horn, weiter in der Firma ‚Chemnitzer Zähne’ des Arthur Thiele zu verharren. Doch auch Lord Liszt, wie ihn Franz Horn in seinem Brief nennt, ist inzwischen in seiner Rolle als rechte Hand des Chefs verdrängt, hat doch Thiele, längst nicht mehr an der Produktion von Zahntechnikerbedarf interessiert, sondern von dem Wunsch getrieben, Surfbretter und Yachten zu bauen, den jungen „Austro-Finnen“ Rudolf Ryynänen angeheuert.
„Hat Liszt zu Zeiten, als seine Stellung noch durch keinen Ryynänen bedroht war, über Thiele samt Familie gelästert – was Horn damals entsetzt hat -, so gibt er sich nun als Anhänger und Bewunderer, vor allem aber als enger Vertrauter der Thieles. Horn dagegen sieht Thieles Abstieg als Basis, endlich mit dem Kollegen auf einen freundschaftlichen Fuß zu kommen, sich sozusagen zu verbünden: ‚[…] hätten Sie gesagt: Franz Horn, ich bin jetzt auch so weit! wir gehören zusammen! dann wäre ich Ihnen entgegengesunken. Aber einfach so tun, als kämen Sie mir als Unbeschädigter entgegen, als wollten Sie mich endlich erheben oder zulassen auf Ihrem Niveau… nein, nein! nicht mit mir.’“
Franz Horn schreibt sich in seinem Brief an Liszt gewissermaßen seinen Frust von der Seele. Es ist der Frust eines vom alltägliche Krieg des Angestellten zermürbten Lebens, in dessen Büro sich inzwischen das Kauderwelsch der Rationalisierung ausbreitet. Der Brief ist wie eine Therapie:
Es kann sich keiner identifizieren mit dem, der er in den Augen der anderen ist. Aber bevor man sich nicht mit dem, der man für andere ist, identisch erklärt, hat man keinen ruhigen Augenblick. Das ist mein Fall. (S. 142)
Mit der befreienden Erkenntnis, ‚nicht mehr der Vernunft anderer zu Kreuze zu kriechen’, ebnet er sich einen Weg, um wieder in den Besitz der eigenen Vernunft zu kommen., wie im Klappentext heißt. Fast natürlich ist es, dass Horn am Ende den Brief nicht abschickt:
Der Brief an Lord Liszt hatte ihn nicht geschwächt! Auch das Nichtabschicken nicht! In Zukunft würde er jedem, von dem er irrtümlicherweise glaubte, er brauche ihn, einen solchen Nachtbrief schreiben, den man nicht abschicken konnte. Was Besseres gibt es nicht! (S. 153)
Es ist nicht nur ein zweiter Franz Horn-Roman, sondern er weist weitere Verbindungen zu anderen Werken Walsers auf. So finden zwei Vettern Franz Horns in dem Buch Erwähnung, einmal Dr. Gottlieb Zürn, Immobilienmakler und Vermieter eines Feriendomizil bei Überlingen (an Helmut Halm aus Ein fliehendes Pferd (1978)), dem die Romane Das Schwanenhaus (1980), Jagd (1988) und Der Augenblick der Liebe (2004) gewidmet sind – und Xaver Zürn, dem Chauffeur aus Seelenarbeit (1979) – siehe Übersicht Hauptpersonen Romane Martin Walser als PDF.
Nun die beiden Franz Horn-Romane sind aber noch etwas mehr, beide verweisen auf reale Personen. Während Franz Horn in bestimmter Hinsicht das Alter Ego des Autors ist, lassen sich Züge des Dr. Horst Liszt in dem Schriftstellerkollegen und langjährigen Freund Walsers, Uwe Johnson, erkennen. Beide hatten wie Horn und Liszt ein zwiespältiges Verhältnis und sind dann im Streit auseinandergegangen (nachzulesen in der Walser-Biografie von Jörg Magenau). Und in Arthur Thiele wollen viele Literaturwissenschaftler Züge des langjährigen Verlegers des Suhrkamp-Verlags, Siegfried Unseld, erkennen. Soweit ich das beurteilen kann, lassen sich diese Bezüge nachvollziehen.
So oder so hat der ‚Brief an Lord Liszt’ meinen Appetit auf die Gottlieb Zürn-Trilogie angeregt. Den erste Teil (Das Schwanenhaus aus 1980) kenne ich übrigens noch nicht.
Siehe auch die folgenden interessanten Rezensionen:
Hellmuth Karasek über Martin Walser: Brief an Lord Liszt
Schattenwelt der Angestellten
Der alltägliche Krieg – von Rolf Michaelis
Martin Walsers grotesker, trauriger Roman „Brief an Lord Liszt“