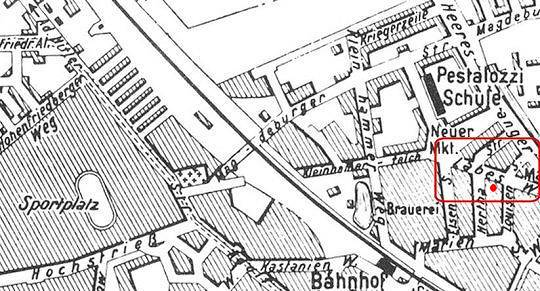Meiner gestrigen Literaturempfehlung bin ich selbst gefolgt und habe mir in einigen Stunden von Jean Paul , dessen 250. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern dürfen, die Erzählung Dr. Katzenbergers Badereise ‚einverleibt’. Es ist ein kleines Reclam-Bändchen aus dem Jahr 1966, das ich vor fast genau 35 Jahren (also 1978) zum ersten Mal gelesen hatte, mit gewissen Schwierigkeiten, wie ich heute noch glaube. Denn Jean Paul „erwarb sich ein reiches Wissen – doch nicht eigentlich zur Förderung seiner Gelehrsamkeit und seiner Bildung, sondern seiner Satiren, für die er hier Stoffe, Bilder, Gleichnisse fand. Er sammelte seine Lesefrüchte in vielen Bänden und erschwert manchmal den Zugang zu seinen Werken durch ein zu weit hergeholtes Material“, wie Otto Mann in einem Nachwort zu der Erzählung schreibt, die immerhin über 200 Jahre alt ist.
, dessen 250. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern dürfen, die Erzählung Dr. Katzenbergers Badereise ‚einverleibt’. Es ist ein kleines Reclam-Bändchen aus dem Jahr 1966, das ich vor fast genau 35 Jahren (also 1978) zum ersten Mal gelesen hatte, mit gewissen Schwierigkeiten, wie ich heute noch glaube. Denn Jean Paul „erwarb sich ein reiches Wissen – doch nicht eigentlich zur Förderung seiner Gelehrsamkeit und seiner Bildung, sondern seiner Satiren, für die er hier Stoffe, Bilder, Gleichnisse fand. Er sammelte seine Lesefrüchte in vielen Bänden und erschwert manchmal den Zugang zu seinen Werken durch ein zu weit hergeholtes Material“, wie Otto Mann in einem Nachwort zu der Erzählung schreibt, die immerhin über 200 Jahre alt ist.
Jean Paul war ein Zeitgenosse Goethes und Schillers, ist aber gegenüber diesen beiden doch ziemlich dem Vergessen anheimgefallen. Ein Grund ist sicherlich dieser etwas ‚erschwerte’ Zugang zu ihm. Und Jean Paul ist herrlich altmodisch. Aber wer sich einmal in ihn vertieft, sich in ihn eingelesen hat, wird mit köstlichen Textperlen beschenkt, die heute so nirgends zu finden sind.
Nun es geht um eine so genannte Badereise eines Dr. Katzenberger nach dem Badeort Maulbronn. Eine Lustreise soll es eigentlich nicht sein, eher eine Geschäftsreise, denn er gedenkt jenen Brunnen-Arzt Strykius beträchtlich auszuprügeln, der seine drei Werke über die Blutmachung, die Missgeburten und die Wasserscheu als Rezensent geschmäht und ihn somit in seiner Ehre angegriffen hat. Seine Tochter Theoda reist mit ihm, da diese gedenkt, in Maulbronn den Bühnen-Dichter Theudobach zu begegnen.
Den Reisenden schließt sich ein Herr von Nieß an, der sich dem Leser schon sehr bald, nicht aber dem verehrten Fräulein Theoda, als eben jener Bühnen-Dichter zu erkennen gibt. Trotz vielerlei Verwicklung und mancherlei Liebeswirren finden Theudobach von Nieß und Theoda dann doch nicht zusammen, denn es tritt ein weiterer Herr Theurobach auf, ein Hauptmann und Verfasser mathematischer Abhandlungen. Dieser samt dem Töchterlein des Dr. Katzenberger werden dann ein Paar:
[…] er hielt sie an der Hand fest, blickte sie an, wollte etwas sagen, ließ aber die Hand fahren und rief: »Ach Gott, ich kann Sie nur nicht weinen sehen.« Sie eilte in einen Felsen-Talweg hinein, er folgte ihr unwillkürlich nach – da fand er sie mit dem Kopfe an eine Felsenzacke gelehnt; sie winkte ihn weg und sagte leise: »O laßt mich weinen, es fehlt mir nichts, es ist nur die dumme Musik.« – »Ich höre keine (sagte der Krieger außer sich und riß sie vom Felsen an sein Herz) – O du himmlisches, gutes Wesen, bleib‘ an meiner Brust – ich meine es redlich, muß ich von dir lassen, so muß ich zugrunde gehen.« Sie schauerte in seinen Armen, das weinende Angesicht hing wie aufgelöset seitwärts herab, die Töne drangen zu heftig ins gespaltene Herz, und seine Worte noch heftiger. »Theoda, so sagst du nichts zu mir?« – »Ach«, antwortete sie, »was hab‘ ich denn zu sagen?« und bedeckte das errötende Gesicht mit seiner Brust. – Da war der ewige Bund des Lebens zwischen zwei festen und reinen Herzen geschlossen.
aus Kapitel 40)
Die Hauptperson ist aber jener Dr. Katzenberger, ein Liebhaber von Kuriositäten, besonders von Missgeburten, die er in einer in Spiritus eingelegten Sammlung sein eigen nennt. Und so dreht sich für ihn alles um seine medizinische Wissenschaft. Von Liebesnöten hält er nicht viel:
Auch er habe sonst als Unverheirateter an Heiraten gedacht und nach der damaligen Mode angebetet – was man zu jener Zeit Adorieren geheißen –; doch sei einem Manne, der plötzlich aus dem strengen mathematisch-anatomischen Heerlager ins Kindergärtchen des Verliebens hinein gemußt, damal zumute gewesen wie einem Lachse, der im Lenze aus seinem Salz-Ozean in süße Flüsse schwimmen muß, um zu laichen. Noch dazu wäre zu seiner Zeit eine bessere Zeit gewesen – damals habe man aus der brennenden Pfeife der Liebe polizeimäßig nie ohne Pfeifendeckel geraucht – man habe von der sogenannten Liebe nirgend in Kutschen und Kellern gesprochen, sondern von Haushalten, von Sich-Einrichten und Ansetzen. So gesteh‘ er z. B. seinerseits, daß er aus Scham nicht gewagt, seine Werbung bei seiner durch die ausgesognen Maikäfer entführten Braut anders einzukleiden als in die wahrhaftige Wendung: nächstens gedenke er sich als Geburthelfer zu setzen in Pira, wisse aber leider, daß junge Männer selten gerufen würden und schwache Praxis hätten, so lange sie unverehlicht wären. – »Freilich«, setzte er hinzu, »war ich damals hölzern in der Liebe, und erst durch die Jahre wird man aus weichem Holze ein hartes, das nachhält.«
»Bei der Trennung von Ihrer Geliebten mag Ihnen doch im Mondscheine das Herz schwer geworden sein?« sagte der Edelmann. »Zwei Pfund – also halb so schwer als meine Haut – ist meines wie Ihres bei Mond- und bei Sonnenlicht schwer«, versetzte der Doktor. »Sie kamen sonach über die empfindsam Epoche, wo alle jungen Leute weinten, leichter hinweg?« fragte Nieß. »Ich hoffe«, sagt‘ er, »ich bin noch darin, da ich scharf verdaue, und ich vergieße täglich so viele stille Tränen als irgend eine edle Seele, nämlich vier Unzen den Tag; nur aber ungesehen (denn die Magenhaut ist mein Schnupftuch); unaufhörlich fließen sie ja bei heilen guten Menschen in den knochigen Nasenkanal und rinnen durch den Schlund in den Magen und erweichen dadrunten manches Herz, das man gekäuet, und das zum Verdauen und Nachkochen da liegt.«
aus (Kapitel 11)
Es ist schon etwas ekelig, wie sich der gute Dr. Katzenberger äußert. In Bad Heilbronn angekommen, interessiert ihn natürlich, bei welchen Krankheiten eine dortige Badekur Linderung verspricht:
Der Doktor hatte nämlich bei der Suppe seinen Wirt gebeten, ihn mit den verschiedenen Krankheiten bekannt zu machen, welche gerade jetzt hier vertrunken und verbadet würden. Strykius wußte, als ein leise auftretender Mann, durchaus nicht, wie er auf deutsch (zumal da außer dem eignen Namen wenig Latinität in ihm war) zugleich die Ohren seines Gastes bewirten, und die der Nachbarinnen beschirmen sollte. »Beim Essen«, sagte eine ältliche Landjunkerin, »hörte sich dergleichen sonst nicht gut.« – »Wenn Sie es des Ekels wegen meinen«, versetzte der Doktor, »so biet‘ ich mich an, Ihnen, noch ehe wir vom Tisch aufstehen, ins Gesicht zu beweisen, daß es, rein genommen, gar keine ekelhafte Gegenstände gebe; ich will mit Ihnen Scherzes halber bloß einige der ekelhaften durchgehen und dann Ihre Empfindung fragen.« Nach einem allgemeinen, mit weiblichen Flachhänden unternommenen Niederschlagen dieser Untersuchung stand er ab davon.
»Gut«, sagt‘ er, »aber dies sei mir erlaubt zu sagen, daß unser Geist sehr groß ist und sehr geistig und unsterblich und immateriell. Denn wäre dieser Umstand nicht, so wartete die Materie vor, und es wäre nicht denklich; denn wo ist nur die geringste Notwendigkeit, daß bei Traurigkeit sich gerade die Tränendrüse, bei Zorn die Gallendrüse ergießen? Wo ist das absolute Band zwischen geistigem Schämen und den Adernklappen, die dazu das Blut auf den Wangen eindämmen? Und so alle Absonderungen hindurch, die den unsterblichen Geist in seinen Taten hienieden teils spornen, teils zäumen? In meiner Jugend, wo noch der Dichtergeist mich besaß und nach seiner Pfeife tanzen ließ, da erinner‘ ich mich noch wohl, daß ich einmal eine ideale Welt gebauet, wo die Natur den Körper ganz entgegengesetzt mit der Seele verbunden hätte. Es war nach der Auferstehung (so dichtete ich); ich stieg in größter Freude aus dem Grabe, aber die Freude, statt daß sie hienieden die Haut gelinde öffnet, drückte sich droben bei mir und bei meinen Freunden durch Erbrechen aus. Da ich mich schämte wegen meiner Blöße, so wurde ich nicht rot, sondern sogenannt preußisch Grün, wie ein Grünspecht. – Beim Zorn sonderten sämtliche Auferstandne bloß album graecum ab. – Bei den zärtern Empfindungen der Liebe bekam man eine Gänsehaut und die Farbe von Gänse-Schwarz, was aber die Sachsen Gänse-Sauer nennen. – Jedes freundliche Wort war mit Gallergießungen verknüpft, jedes scharfe Nachdenken mit Schlucken und Niesen, geringe Freude mit Gähnen. – Bei einem rührenden Abschied floß statt der Tränen viel Speichel. – Betrübnis wirkte nicht wie bei uns auf verminderten Pulsschlag, sondern auf Wolf- und Ochsen-Hunger und Fieber-Durst, und ich sah viele Betrübte Leichentrunk und Leichenessen zugleich einschlucken. – Die Furcht schmeckte mit feinem Wangenrot. – Und feurige, aber zarte Zuneigung der Ehegatten verriet sich, wie jetzt unser Grausen, mit Haarbergan, mit kaltem Schweiß und Lähmung der Arme. – Ja, als …«
aus (Kapitel 24)
Es gibt vielerlei Gesprächsstoff bei den Mahlzeiten. Und als Mediziner kann er von seinem Interesse nicht lassen, alles eben aus dieser, der medizinische Sicht, zu betrachten. Die Nahrungsaufnahme selbst wird hinreichend ‚zergliedert’:
Unter dem Essen lenkte der Doktor die Rede aufs Essen und merkte an, er wundre sich über nichts mehr, als daß man, bei der Seltenheit von Kadavern und vollends von lebendigen Zergliederungen, so wenig den für die Wissenschaft benutze, in dem man selber stecke, besonders im Sommer, wo tote faulen. »Wär‘ es Ihnen zuwider, Herr Mehlhorn, wenn ich jetzo z. B. den Genuß der Speisen zugleich mit einem Genusse von anatomischen Wahrheiten oder Seelenspeisen begleitete?« – »Mit tausend Wohlgefallen, teuerster Herr Doktor«, sagt‘ er, »sobald ich nur kapabel bin, Ihrer gelehrten Zunge zu folgen.« – »Sie brauchen bloß zu meinem Sprechen zu käuen; nämlich bloß von der Käufunktion will ich Ihnen einen kleinen wissenschaftlichen Abriß geben, den Sie auf der Stelle gegen Ihre eigne, als gegen lebendiges Urbild, halten sollen. – Nun gut! – Sie käuen jetzt; wissen Sie aber, daß die Hebelgattung, nach welcher die Käumuskeln Ihre beiden Kiefern bewegen (eigentlich nur den untern), durchaus die schlechteste ist, nämlich die sogenannte dritte, d. h. die Last oder der Bolus ist in der größten Entfernung vom Ruhepunkte des Hebels; daher können Sie mit Ihren Hundzähnen keine Nuß aufreißen, obwohl mit den Weisheitzähnen. Aber weiter! Indem Sie nun den Farsch da auf Ihrem Teller erblicken: so bekommt (bemerken Sie sich jetzt) die Parotis (hier ungefähr liegend) so wie auch die Speicheldrüse des Unterkiefers Erektionen, und endlich gießt sie durch den stenonischen Gang dem Farsche den nötigen Speichel zu, dessen Schaum Sie, wie jeder andere, bloß den ausdehnenden Luftarten verdanken. Ich bitte Sie, lieber Zoller, fortzukäuen, denn nun fließet noch aus dem ductus nasalis und aus den Tränendrüsen alles nach, woraus Sie Hoffnung schöpfen, so viel zu verdauen, als Sie hier verzehren. Nach diesem Seedienst kommt der Landdienst.« –
Hier lachte der Zoller über die Maßen, teils um höflich zu erscheinen, teils das Mißbehagen zu verhehlen, womit er unter diesem Privatissimum von Lehr-Kursus alles verschlang; – gleichwohl mußt‘ er fortfahren, zu genießen. –
»Ich meine unter dem Landdienst dies: jetzt greift Ihr Trompetermuskel ein und treibt den Farsch unter die Zähne – Ihre Zunge und Ihre Backen stehen ihm bei und wenden und schaufeln hin und her – ausbeugen kann der Farsch unmöglich – auswandern ebenso wenig, weil Sie ihn mit zwei häutigen Klappen (Wangen im gemeinen Leben) und noch mit dem Ringmuskel oder Sphinkter des Mundes (dies ist nur Ihr erster Sphinkter, nicht Ihr letzter, damit korrespondierender, was sich hier nicht weiter zeigen läßt) auf das schärfste inhaftieren und einklammern – kurz der Farsch wird trefflich zu einem sogenannten Bissen, wie ich sehe, zugehobelt und eingefeuchtet. – Nun haben Sie nichts weiter zu tun (und ich bitte Sie um diese Gefälligkeit), als den fertigen Bolus in die Rachenhöhle, in den Schlundkopf abzufahren. Hier aber hört die Allmacht Ihres Geistes, mein Umgelder, gleichsam an einem Grenzkordon auf, und es kommt nun nicht mehr auf jenes ebenso unerklärliche als erhabne Vermögen der Freiheit (unser Unterschied von den Tieren) an, ob Sie den Farsch-Bissen hinunterschlucken wollen oder nicht (den Sie noch vor wenigen Sekunden auf den Teller speien konnten), sondern Sie müssen, an die Sperrkette oder Trense Ihres Schlundes geheftet, ihn nun hinabschlingen. Jetzt kommt es auf meine gütige Zuhörerschaft an, ob wir den Bissen des Herrn Zollers begleiten wollen auf seinen ersten Wegen, bis wir weiterkommen.« –
Mehlhorn, dem der Farsch so schmeckte wie Teufelsdreck, versetzte: »Wie gern er seines Parts dergleichen vernehme, brauch‘ er wohl nicht zu beschwören; aber auf ihn allein komm‘ es freilich nicht an.« – »Ich darf denn fortfahren?« sagte der Doktor. »Vortrefflicher Herr«, versetzte eine ältliche Dame, »Ihr Diskurs ist gewiß über alles gelehrt, aber unter dem Essen macht er wie desperat.«
aus (Kapitel 38)
Nun, 2013 ist ein Jean Paul-Jahr – ein Jahr, um den Dichter aus dem Oberfränkischen wieder zu entdecken. Ich würde es mir gern wünschen.
zu sprechen. Ich bin in diesem Roman über viele so genannte Redensarten gestolpert, die, obwohl der Roman inzwischen 89 Jahre auf dem Buckel hat, überraschend aktuell sind, d.h. wir verstehen auch heute noch (meist) die eigentliche Bedeutung, die sich hinter einem saloppen Spruch verbirgt. Ich deutet es als ein positives Zeichen, das belegt, dass unser Wortschatz sich eher vermehrt als abnimmt.
![]()