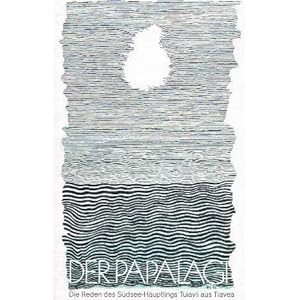„Martin Walser erzählt in seinem Roman Finks Krieg von dem Konflikt um eine Stellenbesetzung in der Hessischen Staatskanzlei, der sich von 1988 bis 1994 tatsächlich zugetragen hat. Im Mittelpunkt der Ereignisse steht der Leitende Ministerialrat Stefan Fink, der in der Staatskanzlei für die Verbindung zu den Kirchen zuständig ist. Als er im Zuge einer politischen Veränderung, einer Intrige, versetzt werden soll, wehrt er sich und führt, mit der Zeit immer einsamer werdend, einen langen Kampf über viele Instanzen, der Formen eines persönlichen Krieges annimmt. Je länger er diesen Kampf führt, desto mehr muß er erfahren, daß sein Krieg eben nur sein Krieg ist. Alle raten, diesen zu beenden, Fink dagegen ist der Meinung: ‚Jemand, der um sein Leben kämpft, kann nicht aufhören, um sein Leben zu kämpfen.’“
(aus dem Klappentext)
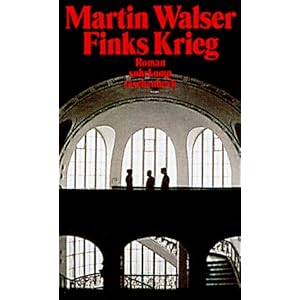
Walsers Roman habe ich als Taschenbuch (Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt/Main – st 2900 – erste Auflage 1998) vorliegen und erneut vor Weihnachten 2012 gelesen. Wie im Klappentext erwähnt bezieht sich der Roman auf einen tatsächlich zugetragenen Fall, den Fall des Rudolf Wirtz. Zum Hintergrund ist u.a. bei FOCUS Online im Artikel Schlacht der Leitz-Ordner zu lesen:
„Rudolf Wirtz, Katholik, Sozialdemokrat, seit 1970 Leitender Ministerialrat in der hessischen Staatskanzlei zu Wiesbaden, zuständig für Kontakte zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften des Landes, wurde am 23. November 1988 über seine Versetzung informiert. Der Beamte fiel beim Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Alexander Gauland (CDU), in Ungnade, weil sich angeblich Kirchenvertreter über ihn, Wirtz, beklagt hätten. In zwei Eilverfahren wehrte er sich erfolgreich gegen die Versetzung. Gaulands durch eine eidesstattliche Versicherung untermauerter Verdacht gegen Wirtz wurde von den Kirchen weder bestätigt noch dementiert.
Zum vorläufigen Sieg des Beamten Wirtz trug auch bei, daß sich sein vermeintlicher Nachfolger, Wolfgang Egerter (CDU), als aktives Mitglied des völkischen Witiko-Bundes entpuppte und somit als untragbar für ein Amt, das unter anderem auch mit der jüdischen Gemeinde Kontakte zu pflegen hat. Um es kurz zu machen: Die rot-grüne Opposition meldete sich zu Wort, vornehmlich in Person von Joschka Fischer. Der forderte, vergeblich, die Entlassung Gaulands, bezeichnete später sein Verhalten gegenüber Gauland aber als ‚Fehler’.
Immerhin: Der Fall Wirtz avancierte zum Politikum. Am Ende blieb der Beamte in seinem Amt, womit er sich allerdings nicht zufrieden gab. Mit juristischen Mitteln wollte Wirtz Gaulands eidesstattliche Versicherung widerlegen, die Kirchen hätten sich unzufrieden über ihn, Wirtz, geäußert. Doch das Ermittlungsverfahren gegen Gauland wurde eingestellt. Der Fall Wirtz versickerte im Sande.“
Sicherlich benötigt der Leser dieses Romans einen gewissen Nerv, denn der finksche Karriere-Fall ist eigentlich nicht die Welt. Aber es ist doch erstaunlich, wie sich Martin Walser dieses Stoffs angenommen hat und in die Rolle des Stefan Fink alias Rudolf Wirtz geschlüpft ist. Beim Erscheinen des Buchs gab es den Vorwurf, Walsers ‚Psychologie’ stimme nicht so ganz. Aber es ist ja nicht Walser, der schreibt, sondern durch ihn schreibt der Beamte Fink. Und dessen Sichtweise wird im Laufe der Zeit immer verschrobener und lässt den Ich-Erzähler Fink zunehmend von sich selbst in der dritten Person reden. Sein Monolog wird zum ‚Selbstentzweiungsgespräch’. Ein altmodischer Mann, dem es um die Ehre geht – ‚der Posten war mein Lebenswerk’ (siehe hierzu den Artikel Kohlhaas im Amt – spiegel.de).
„Sein Kampf um Rehabilitierung nimmt bald kafkaeske Züge an und erinnert an Michael Kohlhaas; bald kann Fink an nichts anderes mehr denken. Das juristisch-bürokratische wird von einem kriegerischen Vokabular abgelöst.“ (Quelle: dieterwunderlich.de)
Sitzen bleiben mußten wir am Computer und einen Artikel entwerfen für eine noch zu findende, wenn nicht sogar zu erfindende Zeitschrift. Einen Artikel gegen das System, aber das Wort System durfte nicht vorkommen. Der Linguist hatte gerügt, daß der Beamte Fink alles, wogegen er anrenne, System nenne. So aber sei die Weimarer Republik von den Nazis genannt worden. Und überhaupt habe der Beamte Fink mit Don Quijote gemeinsam, daß er Erscheinungen so lange auf bausche, bis eine Windmühle herauskomme, gegen deren mächtige Flügel er dann anrennen könne. Das System, das sei die übermächtige Windmühle des Beamten Fink. Zum Schein hatte der Beamte Fink gefragt, wie er denn den Gegner zusammenfassend bezeichnen solle. Überhaupt nicht zusammenfassend, hatte der Linguist gesagt, differenzierend, analysierend, also auseinandernehmend …
Ach ja, ach ja. Mein Gott! Wie soll jemand, der im Krieg lebt, sich verständigen mit einem, der im Frieden lebt!
Martin Walser: Finks Krieg (S. 99 f)
Die vier Kapitel des Romans:
I. Der Rausschmiss [23.11.1988]
II. Unperson
III. Distelblüten
IV. Höhengewinn mit Tractatus skatologikus [etwa: Abhandlung vom Kot] oder Cacata Charta [etwa: Scheiß-Urkunde]
Geschichtlicher Hintergrund (Landesregierung Hessen):
11. Legislaturperiode 1983-87
Wörner SPD ab Oktober 1985 mit den Grünen (u.a. J. Fischer)
12. Legislaturperiode 1987-91
Wallmann CDU mit FDP
13. Legislaturperiode 1991-95
Eichel SPD mit den Grünen
Sicherlich ist dieser Roman nicht jedermanns Sache. Vielleicht sollte man selbst die Strukturen behördlicher Einrichtungen kennen gelernt haben, um einen gewissen Geschmack an diesem Roman zu finden. Man sagt, „Gottes Mühlen mahlen langsam“ und ergänzt das dann mit: „die des Staates aber noch langsamer!“. Bürokratie – und in Übersteigerung der Bürokratismus – findet sich im Besonderen bei staatlichen Stellen und ist als Beamtenwirtschaft verschrieen. Wer in die Zwickmühle des Staates gerät, findet kaum einen Ausweg heraus. Von daher gelingt Martin Walser mit diesem Roman eine Art Lehrstück zu diesem Thema.
Stefan Fink ist sicherlich ein gesitteter Mensch. Aber mit zunehmender Zeit im Verlauf des Verfahrens ‚verroht’ er förmlich und schmeißt mit Fäkalausdrücken um sich, dass es nur so kracht. Wer könnte sich nicht selbst manchmal mit dem Beamten Fink identifizieren?!
„Seit Koeppens Treibhaus 1953 erschienen ist, hat es ein besseres Buch über das leise Verhältnis von Macht und Wahn nicht gegeben.“ Frank Schirrmacher, Frankfurter Allgemeine Zeitung