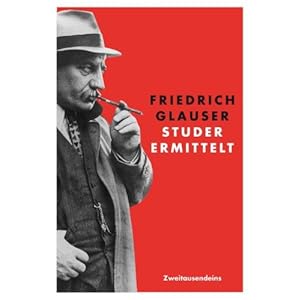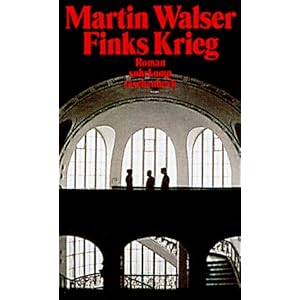„Warum hat Kain Abel erschlagen?“
„Weil Abel ihm alte jüdische Witze erzählt hat.“
Eigentlich mag ich es nicht, wenn in Gesellschaft Leute meinen, die Stimmung durch das Erzählen von Witzen heben zu müssen. Meist sind es schlüpfrige, also ‚unanständige’ Witze, bei denen dann mindestens die Hälfte der Anwesenden pikiert daherschaut. Oder es sind Witze mit langem Bart, also Witze, die man schon zum tausendsten Mal gehört hat. Und bei manchem Kalauer stöhnt dann bereits die ganze Mannschaft. Geistreiche, vielleicht auf Wortspiele beruhende Witze sind doch eher selten.
Wenn ich Witze mag, dann sind es oft Witze, die man dem ‚trockenen’ bzw. dem schwarzen Humor zurechnet, z.B. also den britischen Humor mit seinen oft absurden Elementen wie bei Monty Python oder in Deutschland bei Loriot. Die Grenzen des guten Geschmacks sollten nicht unbedingt überschritten werden.
Eine besondere Art ist der jüdische Witz:
„Der jüdische Witz nimmt in der Weltliteratur eine Sonderstellung ein. Er ist tiefer, bitterer, schärfer, vollendeter, dichter, und man kann sagen, dichterischer als der Witz anderer Völker. Ein jüdischer Witz ist niemals Witz um des Witzes willen, immer enthält er eine religiöse, politische, soziale oder philosophische Kritik; und was ihn so faszinierend macht: er ist zugleich Volks- und Bildungswitz zugleich, jedem verständlich und doch voll tiefer Weisheit.
Durch Jahrhunderte war der Witz die einzige und unentbehrliche Waffe des sonst waffen- und wehrlosen Volkes. Es gab – besonders in der Neuzeit – Situationen, die von den Juden seelisch und geistig überhaupt nur mit Hilfe ihres Witzes bewältigt werden konnten. So lässt sich behaupten: Der Witz der Juden ist identisch mit ihrem Mut, trotz allem weiterzuleben. – Salcia Landmann hat es unternommen, die verstreuten und oft nur mündlich überlieferten jüdischen Witze zu sammeln und zu ordnen. Ihre Auswahl, die alle thematischen bereiche umfaßt, geht eine soziologische Interpretation voraus, in der zugleich über Herkunft, Geschichte und Niedergang des jüdischen Witzes berichtet wird.“
(aus dem Klappentext)
„Zweierlei wollte ich mit meinem Buche: den tragischen Hintergrund des jüdischen Witzes aufzeigen, und diesen Witz selber heute, nach dem Untergang des europäischen Judentums, für den deutschsprachigen Leser sammeln und vor dem Vergessenwerden bewahren.
[…]
Wohin man blicken mag – die Bedingungen, welche den jüdischen Witz erzeugt haben, findet man nirgends wieder. Ein Teil des jüdischen Volkes hat den Naziterror zu überleben vermocht – nicht aber sein Witz. Er gehört heute der jüdischen Vergangenheit an, genau wie das deutsche Volksmärchen der deutschen Vergangenheit angehört.
Wir können ihn nur noch sammeln, und, solange er uns in seinen Voraussetzungen noch nicht fremd geworden ist, verstehen.“
Salcia Landmann in: Der jüdische Witz und seine Soziologie

Wenn manches nicht so traurig wäre, würde man lachen – sagt man. Der Jude lacht. Und ich habe bei dem Buch Jüdische Witze – ausgewählt und eingeleitet von Salcia Landmann: Der jüdische Witz und seine Soziologie, mit einem Geleitwort von Carlo Schmid – dtv 21017 – Deutscher Taschenbuch Verlag – 5. Auflage 2011 (zuerst erschienen 1960 im Walter Verlag, Olten) mitgelacht.
– ausgewählt und eingeleitet von Salcia Landmann: Der jüdische Witz und seine Soziologie, mit einem Geleitwort von Carlo Schmid – dtv 21017 – Deutscher Taschenbuch Verlag – 5. Auflage 2011 (zuerst erschienen 1960 im Walter Verlag, Olten) mitgelacht.
Die Ostjuden pflegten zu behaupten:
Wenn man einem Bauern einen Witz erzählt, lacht er dreimal. Das erstemal, wenn er den Witz hört, das zweitemal, wenn man ihm den Witz erklärt, das drittemal, wenn er den Witz versteht.
Der Gutsherr lacht zweimal: das erstemal, wenn er den Witz hört, das zweitemal, wenn man ihn erklärt. Verstehen wird er ihn nie.
Der Offizier lacht nur einmal, nämlich wenn man ihm den Witz erzählt. Denn erklären läßt er sich prinzipiell nichts, und verstehen wird er ohnehin nicht …
Erzählt man aber einem Juden einen Witz, so sagt er: „Den kenn ich schon!“ und erzählt einen noch besseren.
Im Laufe seines Lebens hört man viele Witze, ob freiwillig oder nicht. Fast alle vergisst man schnell wieder. So kenne ich nur wenige Witze und diese auch nur, weil sie kurz, also prägnant, etwas absurd und nach meinem Verständnis eben ‚witzig’ sind. Und zwei dieser Witze, die sich mir eingeprägt haben, finden sich in diesem Buch mit jüdischen Witzen, wenn auch in Abwandlung (im zweiten Witz ist es bei mir kein Rebbe, also Rabbi, sondern ein Pastor), seltsamerweise (oder auch nicht) wieder. Es beweist zumindest, dass meine Vorliebe für den jüdischen Witz, wenn auch unbeahnt, schon früh bestand:
Berel, Nichtschwimmer, plätschert im seichten Fluß – plötzlich gerät er in eine tiefe Stelle und brüllt um Hilfe. Schmerel: „Berel, was schreist du?“
„Ich habe keinen Grund!“
„Wenn du keinen Grund hast – was schreist du dann?“ (S. 89)
Ankunft in Krotoschin: „Sagen Sie, wo wohnt der Rebbe?“
„Dort hinüber.“
„Aber da kann doch der Rebbe nicht wohnen, da ist doch der Puff?“
„Nein, der Puff ist hier links.“
„Danke.“ Und geht links. (S. 249)
Auf über 360 Seiten finden sich in dem Buch unzählige Witze – thematisch gegliedert. Es gibt wirklich viel zu lachen – oder zumindest zum Schmunzeln. Hier nur eine kleine Auswahl von Witzen, die mir besonders gefallen haben:
Schmul ist von der Straßenbahn abgesprungen und unsanft auf dem Toches (Gesäß) gelandet.
„Sind Sie niedergefallen?“ fragt ein mitleidiger Passant.
Schmul: „No na, so steig ich immer aus!“ (S. 94)
Gespräch auf dem Bahnsteig.
„Wohin fährst du?“
„Nach Warschau, Holz einkaufen.“
„Wozu die Lüge? Ich weiß doch: wenn du sagst, du fährst nach Warschau, Holz einkaufen, dann fährst du in Wirklichkeit nach Lemberg, Getreide verkaufen. Zufällig weiß ich aber, daß du tatsächlich fährst, um Holz zu kaufen. Warum lügst du also?“ (S. 107)
Joine Nelken sitzt im Theater bei ‚Maria Stuart’. Es wird immer tragischer, und er weint bitter. Plötzlich sagt er zu sich selbst: „Mein Gott, was treib ich daß Ich kenn sie nicht, sie kennt mich nicht – was reg ich mich so auf?“ (S. 274)
Schmul vor dem Goethe-Denkmal: „No – wer ist er schon? Kein Feldherr, kein Kaiser … bloß die ‚Räuber’ hat er geschrieben!“
„Was für Stuß (Unsinn)! Die sind doch von Schiller!“
„No also: Nicht einmal die ‚Räuber’ hat er geschrieben.“ (S. 274)
Ein Jude sitzt neben einem fremden Herrn im Varieté.
Ein Vortragskünstler tritt auf. Der Jude dreht sich seinem Nachbarn zu und flüstert: „Einer von unsere Leut!“
Eine Sängerin tritt auf. „Auch von unsere Leut“, sagt der Jude. Ein Tänzer kommt auf die Bühne. „Auch von unsere Leut“, erklärt der Jude.
„O Jesus!“, stöhnt der Nachbar angewidert.
„Auch von unsere Leut“, bestätigt der Jude. (S. 292)
1933. In einem deutschen Amtsgebäude meldet sich ein Jude mit der Bitte, seinen Namen ändern zu dürfen. Der Beamte: „Im allgemeinen lassen wir uns auf Namensänderungen nicht ein. Aber Sie werden wohl starke Gründe haben. Wie heißen Sie denn?“
„Adolf Stinkfuß.“
„Ja – da muß man schon Verständnis haben. Wie möchten Sie heißen?“
„Moritz Stinkfuß.“ (S. 324)
Weiteres Material zu diesem Buch und natürlich auch Witze findet man unter: Was ist Jüdischer Witz?
Polnisch-jüdisches Sprichwort:
Wenn man arbeitet, hat man keine Zeit, Geld zu verdienen. (S. 201)
Schön ist auch dieser Witz, der den Talmud, eines der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums, zu erklären versucht:
„Joine, du warst doch auf der Jeschiwe (Talmudhochschule). Kannst du mir erklären, was das ist: Talmud?“
„Ich will es dir an einem Beispiel erklären, Schmul. Ich will dir stellen eine talmudische Kasche (Frage, Problem): Zweie fallen durch den Schlot. Einer verschmiert sich mit Ruß, der andere bleibt sauber … welcher wird sich waschen?“
„Der Schmutzige natürlich!“
„Falsch! Der Schmutzige sieht den reinen – also denkt er, er ist auch sauber. Der Reine aber sieht den beschmierten und denkt, es ist auch beschmiert; also wird er sich waschen. – Ich will dir stellen eine zweite Kasche. Die beiden fallen noch einmal durch den Schlot – wer wird sich waschen?“
„Na, ich weiß jetzt schon: der Saubere.“
„Falsch. Der Saubere hat beim waschen gemerkt, daß er sauber war; der Schmutzige dagegen hat begriffen, weshalb der Saubere sich gewaschen hat – und also wäscht sich jetzt der Richtige. – Ich stelle dir die dritte Kasche: Die beiden fallen ein drittes Mal durch den Schlot. Wer wird sich waschen?“
„Von jetzt an natürlich immer der Schmutzige.“
„Wieder falsch! Hast du je erlebt, daß zwei Männer durch den gleichen Schlot fallen – und einer ist sauber und der andere schmutzig?! Siehst du: das ist Talmud.“ (S.98f.)
Vor dem Holocaust gab es etwa 12 Millionen Menschen, die meisten davon in Osteuropa, die eine Sprache sprachen, die heutzutage neben älteren Menschen aller jüdischen Glaubensrichtungen vor allem chassidische Juden als Umgangssprache sprechen: Jiddisch, eine westgermanische Sprache, die aus dem Mittelhochdeutschen hervorging und dabei semitischen und slawischen Elemente benutzt. Über das Jiddische sind viele hebräische Wörter und Begriffe in die deutsche Sprache geflossen, die auch noch heute verwendet werden. Die jiddisch sprechenden Juden nennen diese Sprache Mame-Loschen (wörtlich Muttersprache, Laschón hebräisch = Sprache).
Einige ‚Neuinterpretationen’ jiddischer Begriffe finden sich ebenfalls in diesem Buch – Aus dem Jiddischen Lexikon:
…
Chuzpe (Impertinenz) = Lehrling
Dajes oder Daages (Sorgen) = Bilanz
Mischpoche (Familie, Klan) = beleidigt
Mizwe (religiöses Gebot, Wohltat) = eheliche Pflicht
Nadan (Mitgift) = die Hälfte
Stuß (Unsinn, Quatsch) = Liebe
Tinnef (Dreck) = Hochzeitsgeschenk
Toches (der Allerwerteste) = zweites Gesicht
Usw. (S. 255f.)
Es ist nun schon zwei Jahre her, da hatte ich an dieser Stelle eine 25-teilige Kolumne „Der Witzableiter“ von Eike Christian Hirsch, die 1984 im ZEITmagazin erschien, wiedergegeben und beendet. Wer möchte, findet hierzu den Anfang bzw. das Ende der Kolumne und kann sich – je nachdem – von vorn nach hinten oder von hinten nach vorn durchhangeln (das ist kein Witz):
Der Witzableiter (1): Totaler Blödsinn – ein Rückfall
Der Witzableiter (25): Abschied vom Witz, mit Humor