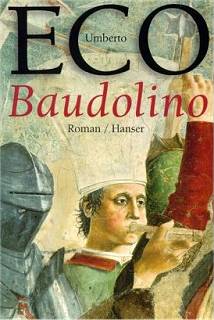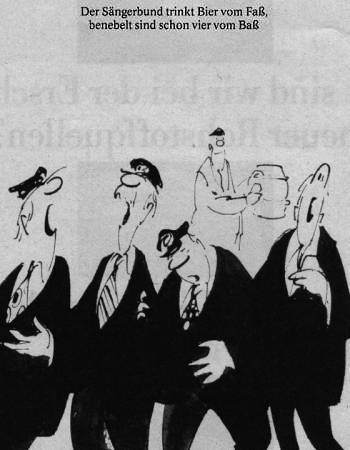Umberto Eco (* 5. Januar 1932 in Alessandria, Piemont) ist uns vor allem als Schriftsteller bekannt. Bis zum Herbst 2007 lehrte er an der Universität Bologna als Sprachwissenschaftler, genauer als Semiotiker. Außerdem ist Eco ein bekannter Kolumnist. Sein bekanntester Roman ist ohne Zweifel Der Name der Rose, 1980 in Italien, 1982 in Deutschland erschienen. Der äußeren Form nach handelt es sich dabei um einen breit angelegter historischer Kriminalroman, der anno 1327 in einer italienischen Benediktinerabtei spielt. Dieser Roman wurde auch erfolgreich mit Sean Connery verfilmt.
Im Jahre 2000 erschien im italienischen Original und 2001 in der deutscher Übersetzung ein weiterer Roman von Umberto Eco, der im Mittelalter spielt: Baudolino . Im Stile eines Schelmenromans wird die Lebensgeschichte des piemontesischen Bauernjungen Baudolino aus der Gegend von Alessandria erzählt, der anno 1154 als etwa Dreizehnjähriger von dem Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa adoptiert worden ist, an dessen Hof erzogen wurde, nach einem Studium in Paris zum Berater des Kaisers in italienischen Dingen aufstieg, 1189 mit dessen Heer zum Dritten Kreuzzug aufbrach, nach abenteuerlichen Reisen in den fernen Osten anno 1204 die Plünderung von Konstantinopel durch die Kreuzritter des Vierten Kreuzzugs miterlebte und einige Jahre später irgendwo im Orient verschollen sein soll.
. Im Stile eines Schelmenromans wird die Lebensgeschichte des piemontesischen Bauernjungen Baudolino aus der Gegend von Alessandria erzählt, der anno 1154 als etwa Dreizehnjähriger von dem Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa adoptiert worden ist, an dessen Hof erzogen wurde, nach einem Studium in Paris zum Berater des Kaisers in italienischen Dingen aufstieg, 1189 mit dessen Heer zum Dritten Kreuzzug aufbrach, nach abenteuerlichen Reisen in den fernen Osten anno 1204 die Plünderung von Konstantinopel durch die Kreuzritter des Vierten Kreuzzugs miterlebte und einige Jahre später irgendwo im Orient verschollen sein soll.
Baudolino ist wahrlich ein Schelm und beeinflusst u.a. durch seine Lügenmärchen nachhaltig die damalige Geschichte, in deren Mitte Friedrich I. Barbarossa steht. Nach Friedrichs Tod beschließt Baudolino, mit seinen Freunden und Getreuen nach Osten zu ziehen, um das Reich des Priesters Johannes zu finden. Diese Expedition führt die Gruppe in ferne Weltgegenden, die von allerlei kuriosen Menschen- und Monsterwesen bewohnt sind – ein phantastischer, teils komischer, teils anrührender, teils dramatischer Streifzug durch die mittelalterliche Mythologie der Fabelwesen.
Ähnlich wie die Legende vom Reich des Priesters Johannes so spielt auch die Legende um den Heiligen Gral eine wichtige Rolle in diesem Roman:
Als Baudolino ihm gegenüber die Wunder des Palastes des Priesterkönigs Johannes erwähnte, rief er ganz aufgeregt: „Ja, von solch einem Schloß oder einem ganz ähnlichen habe ich auch schon in der Bretagne gehört! Es ist das Schloß, in dem sie den Gradal aufbewahren!“
„Was weißt du über den Gradal?“ fragte Boron mit einem plötzlichen Mißtrauen, als hätte Kyot die Hand nach etwas ausgestreckt, das ihm gehörte.
„Was weißt denn du darüber?“ fragte Kyot ebenso mißtrauisch zurück.
„He, he“, mischte sich Baudolinio ein, „wie es scheint, liegt euch beiden sehr viel an diesem Gradal. Was ist das denn? Soweit ich weiß, müßte ein gradalis so etwas wie ein Napf oder eine Schüssel sein.“
„Napf, Schüssel!“ sagte Boron mit mildem Tadel. „Eher ein Kelch.“ Dann, als entschlösse er sich, ein Geheimnis zu lüften: „Ich wundere mich, daß ihr noch nie davon gehört habt. Es ist die kostbarste Reliquie der ganzen Christenheit, der Kelch, in welchem Jesus beim Letzten Abendmahl den Wein in Blut verwandelt hat und in welchem dann Joseph von Arimathia das Blut aus der Seite des Gekreuzigten aufgefangen hat. Manche sagen, der Name dieses Kelches sei Saint Graal, andere sagen statt dessen Sangreal, königliches Blut, denn wer ihn besitze, gehöre dadurch zu einem Geschlecht auserwählter Ritter, die vom selben Stamme seinen wie David und wie Unser Herr Jesus Christus.“
„Graal oder Gradal?“ fragte der Poet, der sofort aufhorchte, wenn er von etwas hörte, das eine Macht verleihen konnte.
„Man weiß es nicht“, sagte Kyot. „Einige sagen auch Grasal und ander Graalz. Und es ist nicht gesagt, daß er ein Kelch ist. Die ihn gesehen haben, erinnern sich nicht an die Form, sondern wissen nur, daß er ein Gegenstand war, der außergewöhnliche Kräfte besaß.“
„Wer hat ihn denn gesehen?“ fragte der Poet.
„Sicher die Ritter, die ihn in Broceliande hüteten. Aber auch von ihnen hat sich jede Spur verloren, ich habe nur Leute kennengelernt, die von ihm erzählen.“
„Es wäre besser, wenn man von dieser Sache weniger erzählen würde und lieber versuchte, mehr darüber zu wissen“, meinte Boron. „dieser junge Mann war gerade in der Bretagne, und kaum hat er davon reden gehört, schon sieht er mich an, als wollte ich ihm etwas wegnehmen, was er gar nicht hat. So geht es allen. Man hört irgendwo vom Gradal reden, und schon glaubt man, man sei der einzige, der ihn finden werde. Ich war auch in der Bretagne, sogar auf den Inseln jenseits des Meeres, ich habe dort volle fünf Jahre verbracht, ohne zu erzählen, nur um zu suchen …“
„Und hast du ihn gefunden?“ fragte Kyot.
„Das Problem ist nicht, den Gradal zu finden, sondern die Ritter, die wußten, wo er sich befand. Ich bin durchs Land gezogen und habe nach ihnen gefragt, aber ich bin ihnen nie begegnet. Vielleicht war ich kein Auserwählter. Und jetzt seht ihr mich hier zwischen alten Pergamenten wühlen in der Hoffnung, eine Spur zu entdecken, die mir beim Durchstreifen jener Wälder entgangen ist …“
„Was reden wir hier eigentlich vom Gradal?“ sagte Baudolino. „Wenn er sich in der Bretagne befindet oder auf jenen Inseln, braucht er uns nicht zu interessieren, denn er hat nichts mit dem Priester Johannes zu tun.“ Falsch, widersprach Kyot, denn wo sich das Schloß befindet, in dem der Gradal gehütet werde, sei nie recht geklärt worden, aber unter den vielen Geschichten, die er gehört habe, sei eine gewesen, nach welcher einer von jenen Rittern, ein gewisser Feirefiz, ihn gefunden und dann einem seiner Söhne geschenkt habe, einem Priester, der später König von Indien geworden sein solle.
„Faseleien“, sagte Boron. „Meinst du, ich hätte jahrelang am falschen Ort gesucht? Wer hat dir denn die Geschichte von diesem Feirefiz erzählt?“
„Jede Geschichte kann gut sein“, meinte der Poet, „und wenn du Kyots Geschichte folgst, kannst du womöglich deinen Gradal finden. Aber im Moment ist es für uns nicht so wichtig, ihn zu finden, sondern erst mal zu klären, ob es sich lohnt, ihn mit dem Priester Johannes zu verbinden. Mein lieber Boron, wir suchen hier nicht einen Gegenstand, sondern jemanden, der über ihn spricht.“ Dann wandte er sich an Baudolino: „Was hältst du davon? Der Priester Johannes besitzt den Gradal, aus ihm bezieht er seine allesüberragende Würde, und die könnte er doch auf Friedrich übertragen, indem er ihm das Ding zum Geschenk macht!“
„Und es könnte derselbe Rubinkelch sein, den der Prinz von Sarandib dem Harun al-Raschid gesandt hat“, regte Solomon an, wobei er vor lauter Erregung begann, durch den zahnlosen Teil seines Mundes zu pfeifen. „Die Sarazenen erehren Jesus als einen großen Propheten, sie könnten den Kelch gefunden haben, und dann könnte Harun ihn seinerseits dem Priester geschenkt haben …“
„Großartig!“ sagte der Poet. „Der Kelch als vorausweisendes Symbol der Wiedergewinnung dessen, was die Mauren zu Unrecht besessen hatten. Von wegen Jerusalem!“
aus Umberto Eco: Baudolino (Carl Hanser Verlag, 2001 – 1. Auflage – S. 157 ff.)
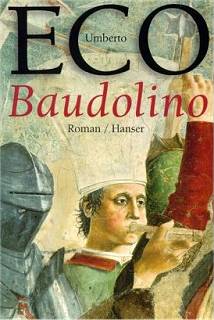
Daneben gibt es eine „schön verrückte Geschichte“ in dem Roman, die sich um Adams Sprache rankt. Nach Abduls Aussage, einem Gefährten des Baudolino, ist das Gälische eine Rekonstruktion der biblischen Ursprache:
„Ich weiß eine schön verrückte Geschichte“, sagte Abdul. „Meine Mutter hat mir immer erzählt, daß die Sprache Adams auf ihrer Insel rekonstruiert worden ist, nämlich in Gestalt der gälischen Sprache, die sich aus neun Wortarten zusammensetzte – Nomen, Pronomen, Verb, Adverb, Partizip, Konjunktion und so weiter -, also aus ebenso vielen wie den neun Materialien, aus denen der Turm zu Babel bestanden habe: Ton und Wasser, Wolle und Blut, Holz und Kalk, Pech, Leinen und Teer … Es seinen die zweiundsiebzig Weisen der Schule von Fenius gewesen, welche die gälische Sprache zusammengebastelt hätten aus Fragmenten aller zweiundsiebzig Idiome, die nach der babylonischen Sprachverwirrung entstanden seien, und daher enthalte das Gälische die besten Elemente aus allen Sprachen und habe, genau wie die Sprache Adams, die gleiche Form wie die geschaffene Welt, so daß in ihr jeder Name das Wesen dessen ausdrücke, was er benenne.“
„Rabbi Solomon lächelte nachsichtig. „Viele Völker glauben, daß die Sprache Adams die ihre sei, wobei sie vergessen, daß Adam nur die Sprache der Torah sprechen konnte, nicht die jener Bücher, die von falschen und lügnerischen Göttern erzählen. Den zweiundsiebzig Sprachen, die nach der Verwirrung entstanden sind, fehlen grundlegende Buchstaben. So kennen die Gojim beispielsweise nicht das Het, und die Araber haben kein Peh, und deswegen ähneln manche Sprachen dem Grunzen der Schweine, andere dem Krächzen der Frösche oder dem Kreischen der Kraniche, und das sind genau die Sprachen von Völkern, welche die richtige Lebensführung aufgegeben haben. Dennoch stand die ursprüngliche Torah im Moment der Schöpfung vor dem Angesicht des Allerhöchsten, heilig sei immerdar der Gesegnete, geschrieben wie schwarzes Feuer auf weißem Feuer, in einer Ordnung, die nicht die der geschriebenen Torah ist, wie wir sie heute lesen, und die sich erst nach dem Sündenfall Adams manifestiert hat. Deshalb verbringe ich jede Nacht Stunden und Stunden damit, in großer Konzentration die Lettern der geschriebenen Torah zu buchstabieren, um sie zu verrühren und kreisen zu lassen wie das Rad einer Windmühle und daraus wiedererstehen zu lassen die ursprüngliche Ordnung der ewigen Torah, die vor der Schöpfung bestand und übergeben wurde den Engeln des Allerhöchsten, gesegnet sei der Heilige immerdar. …“
aus Umberto Eco: Baudolino (Carl Hanser Verlag, 2001 – 1. Auflage – S. 150 f.)
Auf der Suche nach dem Reich des Priesters Johannes landet Baudolino mit seinen Freunden und Getreuen in der Stadt Pndapetzim, in der in schönster Eintracht, aber theologischer Zwietracht (hier lernen wir viele der so genannten Häresien des Mittelalters kennen) ein multikulturelle Völkergewimmel lebt. Die Stadt wird von dem „Diakon Johannes“, der als Stellvertreter des Priesters Johannes über Pndapetzim herrscht, regiert. Hier verliebt sich Baudolino unsterblich in eine feenhafte Jungfrau namens Hypatia, die ihn nicht nur in eine ganz neue Art von Liebe, sondern auch in die Grundzüge der gnostischen Weltsicht und Gottesvorstellung einführt. Der Gnosis entsprechend wird die materielle Welt als böse Schöpfung eines eigenen Schöpfergottes (Demiurg) angesehen, mithin auch der Körper negativ beurteilt wird. Von diesem Demiurgen wird ein vollkommen jenseitiger, oberster Gott unterschieden, vom dem ein göttliches Element stammt, welches als göttlicher Funke im Menschen schlummert und in der materiellen Welt „fremd“ ist. Dieser verborgene Funke muss vom Menschen erkannt werden, um nicht der materiellen Welt verhaftet zu bleiben.
Baudolino stammt wie sein Autor aus Alessandria im Piemont. Den ersten Teil seiner Lebensgeschichte schreibt er noch selbst. Alles weitere erzählt er dem byzantinischen Historiker und hohen Beamten Niketas Choniates, den er aus den Händen marodierender fränkischer Kreuzfahrer gerettet hatte.
Eco lässt den Roman mit einem metafiktionalen Kommentar enden, wenn er dem (historisch verbürgten) Geschichtsschreiber Niketas Choniates folgenden Schlussdialog mit einem erfundenen Freund in den Mund legt:
„Es war eine schöne Geschichte. Schade, dass sie nun niemand erfährt.“
„Glaub nicht, du wärst der einzige Geschichtenverfasser in dieser Welt. Früher oder später wird sie jemand erzählen, der noch verlogener ist als Baudolino.“
Das sollte Umberto Eco sein.