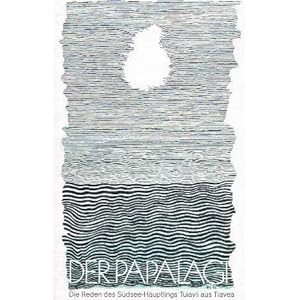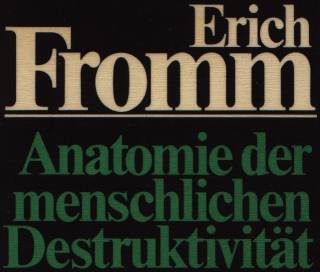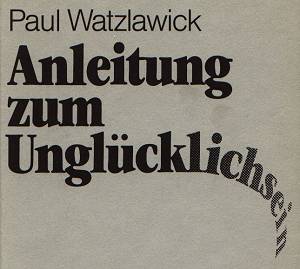Im bereits erwähnten Das Weihnachtsbuch: Mit alten und neuen Geschichten, Gedichten und Liedern (insel taschenbuch it 46) herausgegeben von Elisabeth Borchers – Insel Verlag 1973, das ich als 10. Auflage – 253.-262 Tausend 1980 vorliegen habe, gibt es eine kleine Erzählung von Maxim Gorki, die etwas Herzerfrischendes innehat (siehe online weitere Erzählungen und Bühnenstücke vom Maxim Gorki)

Die Erzählung beginnt in einem spöttischen Ton und nimmt dabei die Massenproduktion von Weihnachtserzählungen, die mit kalendarischer Regelmäßigkeit in russischen Provinzzeitungen erschienen sind, aufs Korn:
In den Weihnachtserzählungen ist es von alther üblich, jährlich mehrere arme Knaben und Mädchen erfrieren zu lassen. Der Knabe oder das Mädchen einer angemessenen Weihnachtserzählung steht gewöhnlich vor dem Fenster eines großen Hauses, ergötzt sich am Anblick des brennenden Weihnachtsbaumes in einem luxuriösen Zimmer und erfriert dann, nachdem es viel Unangenehmes und Bitteres empfunden hat.
Ich verstehe die guten Absichten der Autoren solcher Weihnachtserzählungen, ungeachtet der Grausamkeit, welche die handelnden Personen betrifft; ich weiß, daß sie, diese Autoren, die armen Kinder erfrieren lassen, um die reichen Kinder an ihre Existenz zu erinnern; aber ich persönlich kann mich nicht dazu entschließen, auch nur einen einzigen Knaben oder ein armes Mädchen erfrieren zu lassen, auch zu solch einem sehr achtbaren Zweck nicht. Ich selbst bin nicht erfroren und bin auch nicht beim Erfrieren eines armen Knaben oder armen Mädchens dabeigewesen und fürchte, allerhand lächerliche Dinge zu sagen, wenn ich Empfindungen beim Erfrieren beschreibe, und außerdem ist es peinlich, ein lebendes Wesen erfrieren zu lassen, nur um ein anderes lebendes Wesen an seine Existenz zu erinnern.
Das ist es, weshalb ich es vorziehe, von einem Knaben und einem Mädchen zu erzählen, die nicht erfroren sind. (S. 74f.)
Er folgt die Erzählung der kleinen „Helden – arme Kinder: der Knabe Mischka Pryschtsch und das Mädchen Katjka Rjybaja.“
„Die ‚Weihnachtserzählung’ (Untertitel) von Maksim Gorki, zuerst erschienen in der Zeitung ‚Nizhegorodskij listok’, 1894, 25. Dezember, ist ein interessantes Beispiel für die Frische und Originalität der Erzählweise Gorkis in der ersten Periode seines Schaffens. Vieles ist dort unverkennbar Gorki: der ‚gewiefte Frechdachs’ (opytnyj prostrelenok) Mischka, ein kindliches Exemplar des Bosjaken (Barfüßers) und des Ozornik (Unruhestifters); seine weniger mutige kleine Gefährtin Katjka, die ihn glühend bewundert, und ebenso ihre gemeinsame Arbeit, das mit viel Talent organisierte Handwerk des Bettelns. Das alles wird in einem humorvollen und zärtlichen Ton erzählt, der offensichtlich darauf gerichtet ist, dem Leser die Welt dieser Kinder nahezubringen, seine Rührung und Begeisterung über diese Äußerungen kindlicher Lebensfreude zu wecken und Bewunderung für ihre Fähigkeit, den grausamen Bedingungen ihrer sozialen Umgebung zu widerstehen.“ (Quelle: der-unbekannte-gorki.de)
Beide Kinder erbetteln sich an diesem Abend mehr als einen Rubel, damals viel Geld. Eigentlich müssen sie das Geld an ihre Tante abgeben. Aber an diesem Abend gönnen sie sich einige Kopeken, um sich Essen zu kaufen und in einer schmuddeligen, aber warmen Schenke bei einem Glas Tee einzukehren:
Er schüttelte den Kopf und sagte: „Nun wollen wir essen ..“ „Ja, los!“ stimmte Katjka bei, die schon längst gierige Blicke auf Brot und Wurst geworfen hatte.
Dann begannen sie ihr Abendessen zu verspeisen inmitten des feuchten, übelriechenden Dunkels der mit berußten Lampen schlecht beleuchteten Schenke, im Lärm zynischer Schimpfreden und Lieder. Sie aßen beide mir Gefühl, Verstand und Bedacht, wie echte Feinschmecker. Und wenn Katjka, aus dem Takt kommend, heißhungrig ein großes Stück abbiß, wodurch sich ihre Backen blähten und ihre Augen komisch hervortraten, brummte der bedächtige Mischka spöttisch: „Schau mal einer an, Mütterchen, wie du über das Essen herfällst!“
Das machte sie verlegen, und sie bemühte sich, beinahe erstickend, die wohlschmeckende Kost rasch zu zerkauen.
Nun, das ist auch alles. Jetzt kann ich sie ruhig ihren Weihnachtsabend zu Ende feiern lassen. Glauben Sie mir, sie werden nun nicht mehr erfrieren! Sie sind am richtigen Platz … Wozu sollte ich sie erfrieren lassen ….? Meiner Meinung nach ist es äußerst töricht, Kinder erfrieren zu lassen, welche die Möglichkeit haben, auf gewöhnliche und natürliche Weise zugrunde zu gehen. (S. 84)