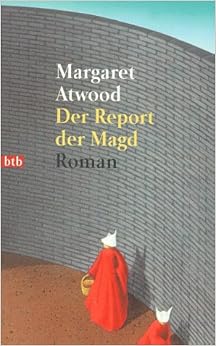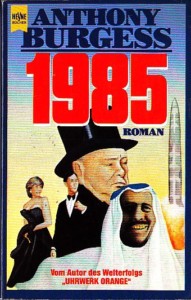„Wir beeilen uns sehr, einen magnetischen Telegraphen zwischen Maine und Texas zu konstruieren, aber Maine und Texas haben möglicherweise gar nichts Wichtiges miteinander zu besprechen. […] Wir beeilen uns, den Atlantischen Ozean zu durchkabeln, um die Alte Welt der Neuen ein paar Wochen näher zu rücken, vielleicht lautet aber die erste Nachricht, die in das große amerikanische Schlappohr hineinrinnt: Prinzessin Adelheid hat den Keuchhusten.“
Neil Postman (* 1931 in New York; † 2003 ebenda) war ein US-amerikanischer Medienwissenschaftler, insbesondere ein Kritiker des Mediums Fernsehen, und in den 1980er-Jahren ein bekannter Sachbuchautor. In Deutschland wurde besonders sein Buch Wir amüsieren uns zu Tode – Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie (mir liegt vor: S. Fischer – 5. Auflage. 82. – 110. Tausend, 1986 – aus dem Amerikanischen übersetzt von Reinhard Kaiser – Original: Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business, 1985) bekannt.
– Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie (mir liegt vor: S. Fischer – 5. Auflage. 82. – 110. Tausend, 1986 – aus dem Amerikanischen übersetzt von Reinhard Kaiser – Original: Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business, 1985) bekannt.

„Orwell fürchtete diejenigen, die Bücher verbieten. Huxley befürchtete, daß es eines Tages keinen Grund mehr geben könnte, Bücher zu verbieten, weil keiner mehr da ist, der Bücher lesen will.“ – „In 1984 […] werden die Menschen kontrolliert, indem man ihnen Schmerz zufügt. In Schöne neue Welt werden sie dadurch kontrolliert, daß man ihnen Vergnügen zufügt. Kurz, Orwell befürchtete, das, was uns verhaßt sei, werde uns zugrunde richten. Huxley befürchtete, das, was wir lieben, werde uns zugrunde richten.
Dieses Buch handelt von der Möglichkeit, daß Huxley und nicht Orwell recht hatte.“ (aus der Einleitung, S. 7f.)
„ […] kündigt [Postmans] Buch […] neuen, grundsätzlichen Meinungsstreit an. Denn diesmal kritisiert er die allmähliche Zerrüttung der Kulturtätigkeiten durch den gewerbsmäßigen Illusionismus, das totale Entertainment. Postmans These lautet, daß die Medien zunehmend nicht nur bestimmen, was wir kennenlernen und erleben, welche Erfahrungen wir sammeln, wie wir Wissen ausbilden, sondern auch, was und wie wir denken, was und wie wir empfinden, ja, was wir von uns selbst und voneinander halten sollen. Zum ersten Mal in der Geschichte gewöhnen die Menschen sich daran, statt der Welt ausschließlich Bilder von ihr ernst zu nehmen. An die Stelle der Erkenntnis- und Wahrnehmungsanstrengung tritt das Zerstreuungsgeschäft. Die Folge davon ist ein rapider Verfall der menschlichen Urteilskraft. In ihm steckt eine unmißverständliche Bedrohung: Er macht unmündig oder hält in der Unmündigkeit fest. Und er tastet das gesellschaftliche Fundament der Demokratie an. Wir amüsieren uns zu Tode.“
(aus dem Klappentext)
Neil Postmans Buch beleuchtete Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts die Medienlandschaft der USA, besonders das Fernsehen. Was wir als ‚amerikanische Verhältnisse’ bezeichnen ist längst zu uns nach Europa herübergeschwappt. Von 50 TV-Sender und mehr werden wir in Deutschland 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche berieselt. Das Fernsehen ist lange schon zum Leitmedium bei uns geworden.
„Gegen das ‚dumme Zeug’, das im Fernsehen gesendet wird, habe ich nichts, es ist das beste am Fernsehen, und niemand und nichts wird dadurch ernstlich geschädigt. Schließlich messen wir eine Kultur nicht an den unverhüllten Trivialitäten, die sie hervorbringt, sondern an dem, was sie für bedeutsam erklärt. Hier liegt unser Problem, denn am trivialsten und daher am gefährlichsten ist das Fernsehen, wenn es sich anspruchsvoll gibt und sich als Vermittler bedeutsamer kultureller Botschaften präsentiert. Paradoxerweise verlangen Intellektuelle und Kritiker vom Fernsehen häufig genau dies.“ (S. 26 f.)
Postmans Kritik am Fernsehen gilt natürlich auch heute noch und lässt sich mit Einschränkungen auch auf das Internet ausweiten. Aber beginnen wir in einer Zeit, in der bereits Henry David Thoreau die anfangs erwähnte ‚Belanglosigkeit’ einer Mitte des 19. Jahrhundert aufkommenden neuen technischen Errungenschaft, die Telegrafie, erkannte.
„Der Angriff des Telegraphen auf die aus dem Buchdruck erwachsene Definition von Urteilsbildung hatte drei Stoßrichtungen: Er verschaffte der Belanglosigkeit, der Handlungsunfähigkeit und der Zusammenhanglosigkeit Eingang in den Diskurs. Entfesselt wurden diese bösen Geister des Diskurses dadurch, daß die Telegraphie der Idee der kontextlosen Information Legitimität verlieh, also der Vorstellung, daß sich der Wert einer Information nicht unbedingt an ihrer etwaigen Funktion für das soziale und politische Entscheiden und Handeln bemißt, sondern einfach daher rühren kann, daß sie neu, interessant und merkwürdig ist. Der Telegraph machte aus der Information eine Ware, ein ‚Ding’, das man ohne Rücksicht auf seinen Nutzen oder seine Bedeutung kaufen und verkaufen konnte.“ (S. 85)
Zuvor waren es die Druckpresse, der Buchdruck, die den Diskurs bestimmten: „Ich möchte die Zeit, in der der amerikanische Geist unter der Souveränität der Druckpresse stand, das Zeitalter der Erörterung nennen. Die Erörterung ist zugleich Denkweise, Lernmethode und Ausdrucksmittel. Fast alle Eigenschaften, die wir einem entfalteten Diskurs zuordnen, wurden durch den Buchdruck verstärkt, der die stärkste Tendenz zu einer erörternden Darstellungsweise aufweist: die hochentwickelte Fähigkeit zu begrifflichem, deduktivem, folgerichtigem Denken, die Wertschätzung von Vernunft und Ordnung; der Abscheu vor inneren Widersprüchen, die Fähigkeit zur Distanz und zur Objektivität; die Fähigkeit, auf endgültige Antworten zu warten.“ (S. 82)
Mit der Zeit bestimmten Bilder, weniger das geschriebene Wort die Medienlandschaft: Manches Bild sagte plötzlich mehr aus als viele Worte:
„Die neuen Bildformen mit der Photographie in vorderster Linie traten nicht als bloße Ergänzung von Sprache auf, sie waren vielmehr bestrebt, die Sprache als unser wichtigstes Instrument zur Deutung, zum Begreifen und Prüfen der Realität zu ersetzen. […] Dadurch, daß das Bild in den Mittelpunkt des Interesses trat, wurden die überkommenden Definitionen der Information, der Nachricht und in erheblichen Umfang der Realität selbst untergraben.“ (S. 95)
„‚Bilder’, so hat Gavriel Salomon geschrieben, ‚muß man erkennen, Wörter muß man verstehen’. Damit will er sagen, daß die Photographie die Welt als Gegenstand präsentiert, während die Sprache sie als Idee präsentiert.“ (S. 93)
Es geht dabei nicht um Falschinformationen, sondern um Desinformationen: „Desinformation ist nicht dasselbe wie Falschinformation. Desinformation bedeutet irreführende Information – unangebrachte, irrelevante, bruchstückhafte oder oberflächliche Information -, Information, die vortäuscht, man wisse etwas, während sie einen in Wirklichkeit vom Wissen weglockt. […] Unwissenheit läßt sich allemal beheben. Aber was sollen wir tun, wenn wir die Unwissenheit für Wissen halten?“ (S. 133 f.)
„Wenn ein Volk sich von Trivialitäten ablenken läßt; wenn das kulturelle Leben neu bestimmt wird als eine endlose Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen, als gigantischer Amüsierbetrieb, wenn der öffentliche Diskurs zum unterschiedslosen Geplapper wird, kurz, wenn aus Bürgern Zuschauer werden und ihre öffentlichen Angelegenheiten zur Varieté-Nummer herunterkommen, dann ist die Nation in Gefahr – das Absterben der Kultur wird zur realen Bedrohung.“ (S. 190)
Wie kann man dem aber entgegenwirken? „Das Problem besteht … nicht darin, was die Leute sehen. Es besteht darin, daß wir sehen. Und die Lösung müssen wir darin suchen, wie wir sehen.“ (S. 194)
Postman setzt dabei auf die Schulen und die Erziehung: „Schon immer galt die Schule in Amerika als Patentlösung für alle bedrohlichen sozialen Konflikte, und ein solcher Vorschlag beruht natürlich auf einen naiven Vertrauen in die Wirksamkeit von Erziehung.“ (S. 197)
… und weiter: „Die Lösung, die ich hier vorschlage, ist die gleiche, die Aldous Huxley vorgeschlagen hat. Und ich kann es nicht besser als er. Er meinte mit H. G. Wells, daß wir in ein Wettrennen zwischen der Bildung und der Katastrophe eingetreten sind, und immer wieder hat er in seinen Schriften betont, wie dringlich es sei, die Politik und die Epistemologie der Medien begreifen zu lernen. Letzten Endes wollte er uns zu verstehen geben: Die Menschen in Schöne neue Welt leiden nicht daran, daß sie lachen, statt nachzudenken, sondern daran, daß sie nicht wissen, worüber sie lachen und warum sie aufgehört haben, nachzudenken.“ (S. 198)
Computer spielten vor knapp dreißig Jahren noch nicht die Rolle, die sie heute spielen samt Internet und all den sozialen Medien. In vielem lässt sich Postmans Kritik am Fernsehen auch auf das Internet übertragen. Besonders die sozialen Medien strotzen geradezu von Belanglosigkeiten und unnötigem Wissen. Auf der anderen Seite bietet das Internet aber die Möglichkeit, schnell an Informationen zu kommen, die man z.B. für die Arbeit, aber auch privat benötigt. Hier gilt natürlich, was für Medien anderer Art (Bücher eingeschlossen) ebenso gilt: Informationen sind an anderer Stelle auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
Es ist wenig, was Postman zu Computern schreibt, u.a.: „ … daß die Speicherung gewaltiger Datenmengen und ihre lichtgeschwinde Abrufbarkeit zwar für große Organisationen von hohem Wert sind, daß sie den meisten Menschen aber bei wichtigen Entscheidungsfindungen wenig geholfen und mindestens ebenso viele Probleme hervorgebracht wie gelöst haben.“ (S. 196) – Der erste Halbsatz ließ mich aufhorchen, denn da kam mir natürlich sogleich der NSA-Skandal in den Sinn.
Neil Postmans Buch ist auch heute noch aktuell, wenn sich die ‚Akzente’ auch deutlich verschoben haben. Es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an – und darin besteht ja der Lösungsansatz, den Postman vertritt: das Erkennen der Gefahr für Kultur und Demokratie, die durch ein Überangebot an belanglosen Informationen hervorgerufen wird. Ich habe es auf jeden Fall mit großem Interesse erneut gelesen.
Zu Huxleys ‚Schöne neue Welt’ und Orwells ‚1984’ sowie zu den Verfilmungen beider Romane komme ich demnächst zu sprechen.
Siehe auch meine Beiträge:
Jugendkriminalität und das geschriebene Wort
Die Philosophie der Uhr
ein Beispiel einer negativen Utopie gegeben, dem die Kritik den visionären Rang von Orwells ‚1984’ und Huxleys ‚Brave New World’ attestiert hat. Margaret Atwood, 1939 in Ottawa geboren, zählt zu den prominentesten Autorinnen der kanadischen Gegenwartsliteratur. Sie schreibt Gedichte, Romane, Prosastücke, Kritiken und Essays. ‚Der Report der Magd’ ist ihr wohl größter Romanerfolg und wurde von Volker Schlöndorff 1990 unter dem Titel Die Geschichte der Dienerin verfilmt. Margaret Atwood wird in diesem Jahr 75 Jahre alt.