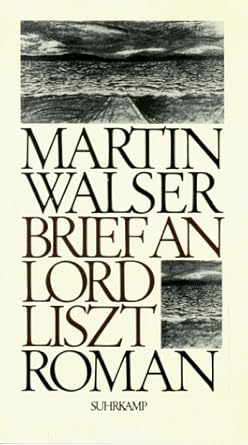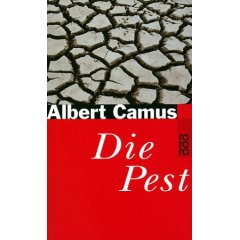Wer Kafka verstehen will, muss sich auch mit seinem Judentum auseinandersetzen. So wurde Kafka – aber nicht nur er allein – für mich zum Ausgangspunkt, mich mit jüdischer, speziell mit jiddischer Literatur zu beschäftigen. Als Einstieg boten sich da die Erzählungen und Romane von Isaac B. Singer an, der 1978 als erster und bisher einziger jiddischer Schriftsteller für sein Gesamtwerk den Literaturnobelpreis erhielt. Auch in Deutschland wurde besonders sein Roman „Feinde – die Geschichte einer Liebe“ aus dem Jahr 1966 (1974 in Deutschland erschienen) bekannt, der 1989 durch Paul Mazursky verfilmt wurde. 1983 wurde Singers Kurzgeschichte „Yentl, the Yeshiva Boy“ mit Barbra Streisand in der Hauptrolle als Yentl verfilmt; dem Film stand Singer allerdings sehr kritisch gegenüber. Isaac Bashevis Singer beschreibt u.a. das jüdisch-polnische Leben im Schtetl, später das Leben der Juden in den USA. Es ist eine wundersame Welt mit einem ganz eigenen Humor, die sich da dem Leser auftut. Singers Werk steht im Spannungsfeld zwischen Religion und Moderne, Mystizismus und rationaler Einsicht. Später einmal werde ich auf ihn noch ausführlicher zu sprechen kommen.
Siehe hierzu auch meine Beiträge:
Hob Ikh Mir A Mantl – Jiddisch für Anfänger
A Serious Man
Salcia Landmann: Jüdische Witze
Scholem Alejchem (* 1859 in Perejaslaw bei Kiew; † 13. Mai 1916 in New York) war einer der bedeutendsten jiddischsprachigen Schriftsteller und wurde auch der jüdische Mark Twain genannt.
Sein Name dürfte den meisten unbekannt sein. Anatevka bzw. „Der Fiedler auf dem Dach“ (im englischen Original: „Fiddler on the Roof“) werden aber viele kennen. Es ist ein Musical, das 1971 vom Regisseur Norman Jewison verfilmt wurde und auch bei uns in Deutschland bis heute noch sehr beliebt ist. Die Vorlage hierzu war eben der jiddische Roman „Tewje, der Milchmann“ (jiddisch: Tewje der Milchiger) von Scholem Alejchem, der zwischen 1894 und 1916 entstanden ist.
Die Geschichte spielt im Russischen Kaiserreich im ukrainischen Schtetl Anatevka in der vorrevolutionären Zeit um 1905. Im Dorf lebt eine jüdische Gemeinschaft, die großen Wert auf Tradition legt. Der Milchmann Tevje (jiddische Koseform des hebräischen Namens Tuvija) lebt mit seiner Frau Golde und seinen Töchtern in Armut. Trotz drohender Pogrome im zaristischen Russland bewahrt Tevje seinen Lebensmut und seinen Humor.
Es ist dieser ganz besondere jüdische Humor, der es mir angetan hat. Daher empfehle ich für heute einen Lesetag als Ruhetag.

Er richtet den Geringen auf aus dem Staube
und erhöhet den Armen aus dem Kot.
Psalm 113,7
Wenn einem der Haupttreffer beschert ist, hört Ihr, Reb Scholem-Alejchem, so kommt er zu einem ganz von selbst ins Haus, wie es in den Psalmen heißt: ›Vorzusingen auf der Githith‹: – wenn man Glück hat, so kommt es von allen Seiten gelaufen; und es gehört gar kein Verstand und keine Tüchtigkeit dazu. Wenn man aber, Gott behüte, kein Glück hat, so kann man reden, bis man zerspringt, und es wird nützen wie der vorjährige Schnee. Wie sagt man doch: ›Es gibt keine Weisheit und keinen Rat gegen ein schlechtes Pferd.‹ Der Mensch arbeitet, der Mensch plagt sich ab, und ist nahe daran, auf alle Feinde Zions sei es gesagt, sich hinzulegen und zu sterben! Und plötzlich kommt, man weiß nicht woher, von allen Seiten lauter Glück und Erfolg, wie es im Buche Esther steht: ›Hilfe und Errettung kommen den Juden.‹ Ich brauche es Euch wohl nicht zu übersetzen, doch der Sinn dieser Stelle ist, daß der Mensch, solange seine Seele in ihm ist, Gottvertrauen haben muß. Das habe ich am eigenen Leibe erfahren, wie der Ewige mich geleitet hat und wie ich zu meinem jetzigen Beruf gekommen bin: denn wie komme ich dazu, Käse und Butter zu verkaufen, wo die Großmutter meiner Großmutter niemals mit Milchwaren gehandelt hat. Es lohnt sich wirklich, die ganze Geschichte vom Anfang bis zum Ende anzuhören. Ich werde mich für eine Weile hier neben Euch ins Gras setzen, und mein Pferdchen soll inzwischen etwas kauen, wie wir es im Morgengebet sagen: ›Die Seele aller Lebenden preiset den Herrn.‹ Und das Pferdchen ist ja auch ein Geschöpf Gottes!
[…]
aus: I. Der Haupttreffer

Scholem Alejchem: Anatewka – Die Geschichte von Tewje, dem Milchmann