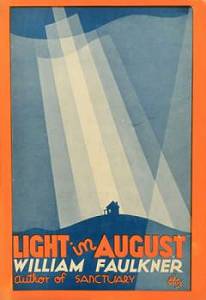- … nicht aufgrund der weißen Schuld, von der die Leute redeten, sondern aus der Notwendigkeit heraus, sich der Zeit und dem Ort zu stellen, denen sie sich durch Geburt, wie sie es verstand, zugehörig fühlte. (S. 27)
Nadine Gordimer, 1923 geboren, ist eine der bekanntesten südafrikanischen Schriftstellerinnen. Ihre Romane, Erzählungen und Essays behandeln vor allem die südafrikanische Apartheidpolitik und deren zerstörerische Folgen sowohl für die schwarze als auch für die weiße Bevölkerung. 1991 wurde sie mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.
Das, was die Protagonistin Vera Stark in Nadine Gordimers Roman Niemand, der mit mir geht sagt, kann auch auf Gordimer selbst bezogen werden. Es geht nicht um ‚weiße Schuld’, es geht darum, sich der Lebenssituation, sich seinem Rechtsempfinden zu stellen, das das Unrecht der Apartheid, der Rassentrennung und Rassensegregation nicht länger dulden kann.

Die Übergangsphase von der Apartheid in Südafrika zur rechtlichen Gleichstellung dauerte von 1990 bis 1994. Während dieser Zeit wurden die verbliebenen Gesetze der Rassentrennung beseitigt. Alle in Südafrika wohnhaften Menschen konnten sich frei und ohne Restriktionen bewegen. Viele Schwarze nutzten diese Chance und zogen in Städte. Diese Übergangszeit war aber auch geprägt durch blutige Unruhen, denn die Führer der so genannten Homelands sahen sich durch das neue Staatssystem in ihrer Macht bedroht. Die Unruhen forderten insgesamt etwa 7.000 Tote.
In dieser Zeit spielt der Roman von Nadine Gordimer (Niemand, der mit mir geht – Original: None to Accompany Me, 1994 – Aus dem Englischen von Friederike Kuhn – Bechtermünz Verlag – 1998), der in drei Kapitel mit den Titeln Gepäck, Transit und Ankunft gegliedert ist.
Zum Inhalt (Quelle: dieterwunderlich.de):
Die weiße Südafrikanerin Vera ist in zweiter Ehe mit Bennet („Ben“) Stark verheiratet. Ihren ersten Ehemann, dessen Frau sie mit siebzehn geworden war, hatte sie wegen Ben verlassen. Bei der zweiten Hochzeitsfeier war sie schwanger, und einige Monate später kam sie mit ihrem Sohn Ivan nieder. Vera wurde Anwaltsgehilfin und studierte Jura, doch nach der Geburt des zweiten Kindes – der Tochter Annick („Annie“) –, gab sie ihre vielversprechende Position in einer prosperierenden Anwaltssocietät auf. Jetzt – mehr als dreißig Jahre später – engagiert Vera sich in einer juristischen Stiftung, die in den letzten Jahren der Apartheid gegen Zwangsumsiedelungen von Schwarzen kämpfte und seit der gemeinsamen Erklärung des ANC und der Regierung von Frederik Willem de Klerk vom 6. August 1990 zwischen Buren-Farmern und mittellosen Schwarzen zu vermitteln versucht. Ben fühlt sich eigentlich als Künstler, doch um sich und Vera finanziell abzusichern, beteiligt er sich an dem Unternehmen „Promotional Luggage“, das teure Lederwaren herstellt und mit den Firmenlogos der Kunden versieht.
Heimlich hat Vera Stark ein Verhältnis mit dem fünfzehn Jahre jüngeren Österreicher Otto Abarbanel.
Bereits vor der Aufhebung des ANC-Verbots am 3. Februar 1990 kehrte mit Didymus („Didy“) Maqoma einer der Führer aus dem Exil nach Südafrika zurück. Einige Zeit später folgte ihm seine Ehefrau Sibongile („Sally“), und sie ließen auch ihre sechzehnjährige Tochter Mpho aus einem Internat in England kommen. Vera und Ben nahmen die Maqomas fünf Wochen lang bei sich auf, bis sie ein Haus gefunden hatten.
Während Didymus bei den Neuwahlen für die Parteileitung scheitert, rückt Sibongile in den engeren Führungszirkel auf. Bald vertritt sie den ANC auch auf zahlreichen Auslandsreisen.
Mit der Aufhebung der Apartheid ist Südafrika zwar freier geworden, aber nicht sicherer: Vera wird nach Phambili Park gerufen, wo sich eine Gruppe von aus ihren ursprünglichen Wohnorten vertriebenen Schwarzen illegal angesiedelt hatte. Nun wurden sie von Wanderarbeitern aus einem Arbeiterheim in Phambili Park angegriffen. Einige von ihnen kamen ums Leben.
Gemeinsam mit dem Squatterführer Zeph Rapulana sucht Vera den Buren Tertius Odendaal auf, der drei Farmen besitzt: eine vom Großvater über den Vater geerbte, eine von seiner Frau mit in die Ehe gebrachte und eine in den frühen Achtzigerjahren gekaufte. Er weigert sich, Hütten heimatloser Schwarzer auf seinem Land zu dulden, und mit einer Frau oder einem Schwarzen will er darüber auch gar nicht diskutieren: Er schlägt den beiden die Tür vor der Nase zu. Bald darauf kommt es im Odensville Squatter Camp zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Schwarzen und einer von Odendaal angeführten Gruppe. Neun Personen verlieren ihr Leben, vierzehn werden verletzt. Als Vera die Nachricht erhält, sorgt sie sich um Zeph Rapulana. Er ist unter den Verletzten. Odendaal, der behauptet, sich gegen einen bevorstehenden Angriff der Squatter verteidigt zu haben, kommt zwar ungeschoren davon, aber seine Klage gegen eine Gerichtsentscheidung zugunsten einer Schwarzensiedlung in Odensville wird vom obersten Gerichtshof abgewiesen.
Bens Vater zieht zu seinem Sohn und seiner Schwiegertochter. Einige Zeit später erleidet er einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholt. Er stirbt.
Veras Sohn Ivan, der als erfolgreicher Banker in London lebt, teilt seiner Mutter in einem Brief mit, dass er sich von seiner Frau Alice scheiden lassen wird, weil er mit einer anderen Frau zusammenlebt. Die kinderlose Investment-Bankerin heißt Eva; es handelt sich um eine Halbjüdin aus Ungarn, deren Ehemann vor fünf Jahren einem Gehirntumor erlag. Von einer dauerhaften Beziehung mit Eva geht Ivan allerdings nicht aus.
Während Annie vorübergehend bei ihren Eltern wohnt, erhält sie Besuch von ihrer Freundin Lou. Vera kauft eigens eine Couch für Lou, stellt dann aber fest, dass die beiden Frauen weiterhin zusammen im Bett schlafen. Als sie es Ben erzählt, will dieser nicht wahrhaben, dass seine Tochter lesbisch ist. – Einige Zeit später adoptieren Annie und Lou ein schwarzes Mädchen.
Veras junger schwarzer Mitarbeiter Oupa Sejake hat zwar eine Ehefrau und Kinder, aber die leben bei Verwandten in einem Umsiedelungsgebiet. Eines Tages beschweren sich Didymus und Sibongile Maqoma bei Vera aufgebracht darüber, dass Oupa ihre Tochter Mpho geschwängert hat. Vera weiß, dass Mpho auch mit anderen jungen Männern herummachte, aber sie verspricht, der Sechzehnjährigen einen Termin für eine Abtreibung zu besorgen.
Bei einer Dienstreise kommen Vera und Oupa zufällig in die Nähe des Ortes, an dem Oupas Frau und seine Verwandten leben. Obwohl private Abstecher eigentlich verboten sind, fährt Vera mit ihm hin. Nach dem Besuch werden sie mit ihrem Auto angehalten, ausgeraubt und durch Schüsse verletzt. Veras Wunde am Bein verheilt, doch Oupa stirbt an einer Sepsis.
Nachdem Ivans Sohn Adam in London wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und ihm wegen mehrmaliger Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit der Führerschein abgenommen wurde, bittet Ivan seine Eltern, den Siebzehnjährigen für ein Jahr bei sich in Südafrika aufzunehmen.
Adam möchte ausgerechnet mit Mpho ausgehen. Seine Großmutter erzählt ihm, welche Schwierigkeiten sie mit Mphos Eltern hatte, weil das Mädchen von einem ihrer Mitarbeiter geschwängert worden war. Sie bittet ihren Enkel deshalb, sich von Mpho fernzuhalten.
Deren Mutter, die in einer neuen Regierung Ministerin werden könnte, steht inzwischen auf einer Todesliste. Obwohl Didymus keine Waffenerlaubnis hat, begleitet er Sibongile nach Möglichkeit mit einem Revolver unter dem Jackett.
Nachdem das Unternehmen „Promotional Luggage“ in bankrott gegangen ist, fliegt Ben zu seinem Sohn nach London. Vera weiß, dass er nicht mehr zurückkommt.
- Vielleicht macht das Verschwinden des alten Regimes auch die Aufgabe eines alten privaten Lebens möglich. (S. 296)
Da Adam mittlerweile zu einem Freund gezogen ist, braucht sie auch auf ihn keine Rücksicht zu nehmen und kann ihr Haus verkaufen. Vera zieht in einen Anbau des Hauses, das Zeph Rapulana in der Stadt bewohnt.
- Es war ein Verhältnis [gemeint ist das zwischen Vera und Zeph], in dem es Loyalitäten, aber keine Abhängigkeiten gab, Gefühle, die in keiner anerkannten Kategorie eingefangen waren, da sie nicht überprüft werden mußten. (S. 301)
Eines Nachts, als bei ihr ein Wasserrohr bricht und sie ins Haupthaus hinübergeht, um den Haupthahn abzudrehen, stößt sie im Bad auf eine unbekannte Frau, bei der es sich offenbar um eine Geliebte Zephs handelt.
Personen des Romans:
Vera Stark, Mitarbeiterin in einer juristischen Stiftung
Bennet Stark, ihr Mann
Ivan, ihr Sohn
Adam, Ivans Sohn
Annick, genannt Annie, ihre Tochter
Didymus („Didy“) Maqoma
Sibongile („Sally“), seine Frau
Mpho, ihre 16-jährige Tochter
Zeph Rapulana, Squatterführer (Besetzer)
Oupa Sejake, Mitarbeiter von Vera Stark in der juristischen Stiftung
Im Mittelpunkt von Nadine Gordimers Roman steht Vera Stark, eine starke Frau, die „inmitten ihrer politischen und privaten Kontakte ihre persönliche Einsamkeit akzeptiert, um ihre Unabhängigkeit nicht zu verlieren.“ Dass auch heute, rund 20 Jahre nach der Übergangsphase von der Apartheid zur rechtlichen Gleichstellung, weiterhin nicht von Normalität in Südafrika gesprochen werden, beweist der tödliche Polizeieinsatz gegen streikende Arbeiter der südafrikanischen Platinmine in Marikana.
„Wenn Sie glauben, daß der Nobelpreis eine Autorin ruhiger und weniger phantasievoll macht, wird Gordimers neues Werk Ihre These auf eine harte Probe stellen. Und wenn Sie glauben, daß Südafrika nach der Apartheid ein weniger interessanter Schauplatz für die Literatur sein muß, wird NIEMAND, DER MIT MIR GEHT Sie widerlegen.
Dieser erster Roman nach dem Nobelpreis, nach der Apartheid – Gordimers am wenigsten politischer und emotionalster – könnte das beste Werk sein, das sie je geschrieben hat.“
Marie Arana-Ward, The Washington Post
Literarische Werk von Nadine Gordimer