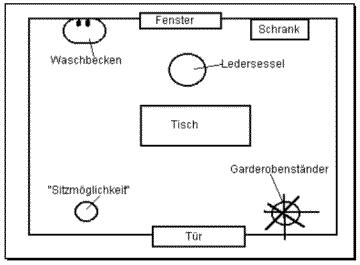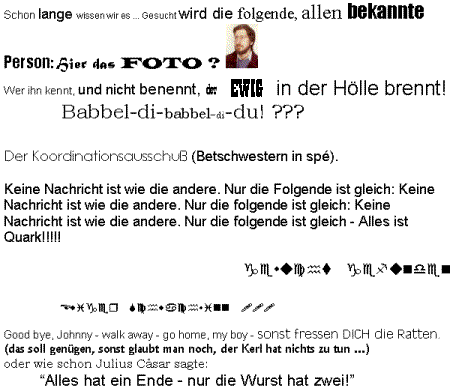Vorbemerkung: Manchmal entscheidet der Anfang eines Romans darüber, ob wir das Buch zu Ende lesen oder nicht. Manche Romane sind geradezu bekannt für ihren Beginn. Mancher Schreiberling und Schriftsteller ist aber über den Start einer Geschichte, ob sie nun als Kurzerzählung oder Roman enden sollte, nicht hinausgekommen. Andere schreiben Romananfänge und nur diese. Die weitere Geschichte interessiert sie nicht.
Ich versuche mich hier an einer neuen Gattung der Prosa und nenne es „plötzlich endender Roman“ (PER), neu-deutsch: „suddenly ending novel“ (SEN), weil’s so schön klingt, wobei ein Hauptmerkmal auf eine möglichst längere Einleitung wie bei einem Romananfang liegt. Die Einführung soll dem Leser suggerieren, dass es eine lange Geschichte werden könnte, die da erzählt wird. Möglichst viele Handlungsstränge werden miteinander verwoben, alles spielt vielleicht auf verschiedenen Zeitebenen (Rückblenden sind bestens geeignet). Aber nach bereits einer Seite soll dann der Paukenschlag kommen: das plötzliche Ende … Schluss und vorbei!
Also wie ein Aufsatz ohne Hauptteil, nur mit Einleitung und Schluss. Wichtig ist vielleicht auch der Titel eines PERs, der möglichst abstrus sein sollte, um den Leser schon hier in die Irre zu führen.
Von meinem ersten PER (ach wie schön können Abkürzungen sein) erhebe ich keinerlei literarischen Anspruch. Die neue Gattung muss erst noch wachsen. Auch gestehe ich, dabei einfach ‚drauflos’ geschrieben zu haben – und dass mir zunächst ‚etwas ganz anderes’ vorschwebte. Vielleicht ist dieses intuitive Schreiben eines der Kennzeichen des PERs.
Der Bruch in der Geschichte, die Stelle, die das plötzliche Ende einleitet, ist sicherlich sehr klischeehaft (ein Vorhang, der zerreißt) – und das Ende ist eher ordinär. Aber, ich hoffe, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Hier also mein erster PER, plötzlich endender Roman:

Leisen Schrittes erstieg er den Gipfel, der ihn eine weite Sicht über die anderen Berge eröffnete. Nie zuvor war er so hoch gestiegen, noch nie blickte er so frei auf das Land seiner Ahnen. Die Milch im Sack war sauer geworden, aber er mochte Saures – und war schon allein der Windzug erfrischend, so schmolz die Flüssigkeit wie Eis in seiner heißen Kehle. Das tat gut. Der Aufstieg hatte ihn durstig gemacht. Und Hunger verspürte er nun auch. Appetit kommt beim Essen oder hier beim Trinken. Das Brot war schimmelig, aber mit dem Messer kratzte er die fauligen Stellen wie eine Wunde sauber, brach sich erst ein Stück mit den Fingern heraus, steckte es in den Mund, und biss dann Stück für Stück aus dem Brot wie ein Wolf das Fleisch aus dem Körper seines Opfers.
Sein Blick war auf einen Punkt in der Ferne gerichtet. Das musste das Gehege sein, in dem der Hirt am Abend seine Schafe zur Nachtruhe treibt. Hier hatte er vor zwei Tagen Quartier zwischen den warmen Körpern der Tiere und nach einem langen Fußmarsch tiefen, traumlosen Schlaf gefunden. Der Hirt hatte ihm am nächsten Tag mit Milch und Brot versorgt. Geld wollte er dafür nicht. Ein Handschlag zum Abschied genügte ihm.
Jetzt stand er also hier oben, nagte am Brot und trank von der sauer gewordenen Milch. Er musste plötzlich an den Bauern denken, der ihn von seinem Hof gescheucht hatte. Mit Herumtreibern, die nur von der Hand in den Mund leben, die vielleicht das Vieh schänden, wollte dieser nichts zu tun haben. Dabei suchte er nur eine Unterkunft für eine Nacht in dem Stroh der Scheune. Einmal ein Dach über dem Kopf haben, nur das wünschte er sich.
So war der Himmel seit Tagen sein Dach in der Nacht.
Vor genau zwei Wochen war er mit der Fähre auf diese Insel gekommen. Im Gepäck, das jetzt in der Hauptstadt in seinem Hotelzimmer auf dem Bett lag, waren die Briefe, die sein Bruder ihn nach Übersee geschrieben hatte, zurückgeblieben. Dieser hatte ihn gebeten, so schnell wie möglich hierher auf die Insel zu kommen. Der Grund war ihm nicht ganz klar. Es sollte aber um viel Geld gehen.
Als er vor 14 Tagen die Reling der Fähre hinabstieg, sein Blick suchte den Bruder auf dem Kai, überkam ihn ein unbeschreibliches Gefühl. Von diesem Hafen aus war er vor mehr als zwölf Jahren in die Welt aufgebrochen. Hier hatte er Kindheit und Jugend zurückgelassen, um in einem fernen Land sein Glück zu suchen.
Als er auf dem Kai stand, den Koffer mit den wenigen Sachen und mit den Briefen des Bruders in der Hand, war von diesem nichts zu sehen. Urplötzlich breitete sich Panik in ihm aus. Warum war sein Bruder nicht da, der ihn doch ausdrücklich von der Fähre abholen wollte? Er versuchte sich zu beruhigen. Der Bruder war sicherlich aufgehalten worden und wird in wenigen Augenblicken mit lachenden Gesicht vor ihm stehen und begrüßen. Als aber auch nach einer vollen Stunde kein Bruder zu sehen war, stieg dieses von ihm so bekannte Gefühl von existenzieller Angst erneut und in voller Wucht in ihm auf.
Hier oben auf dem Gipfel erschien ihn seine Ankunft auf dieser Insel wie ein Traum, eher ein Alptraum, an den man sich plötzlich wieder erinnert, der aber schon Monate zurückliegt. Als der Bruder auch nach einer weiteren Stunde nicht erschienen war, suchte er in der Nähe nach einem Taxi. –
Er stand vor einem völlig verwahrlosten Haus und fragte noch einmal den Taxifahrer, ob das wirklich die Straße wäre, die der Bruder in seiner Adresse angegeben hatte. Straße und Hausnummer stimmten. Völlig ratlos betrat er das Grundstück. Die Pforte war nur angelehnt, der in Stein gefasste Weg zum Haus überwuchert von Unkraut. Es war schon nicht mehr Panik, was ihn beschlich. Es war eine Faust, die sein Herz umklammerte. Sein Atem stockte.
Die Sonne begann zu brennen. Obwohl es auf dem Gipfel des Berges kalt war, fing die Sonne an, ihn zu wärmen. Sein Gesicht rötete sich. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang. Vor ihm stand sein Bruder und fasste ihm am Arm. Wie benommen blickte er auf.
„Wach endlich auf, du Schlafmütze! Es wird Zeit für uns. Ich kann nicht länger warten.“
Was gibt es Beschisseneres als diesen Traum, als diesen Traum im Traum. „Mach die Fliege, ich will noch eine Runde schlafen!“