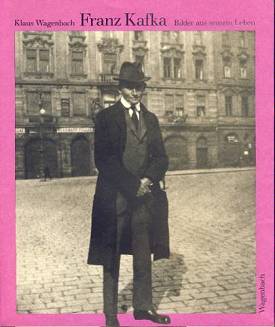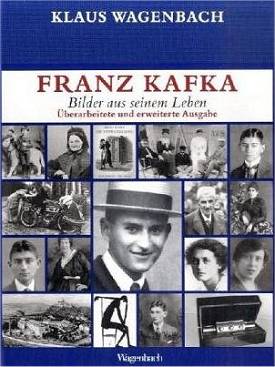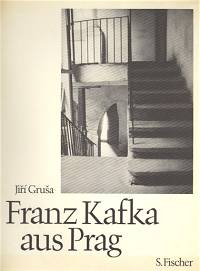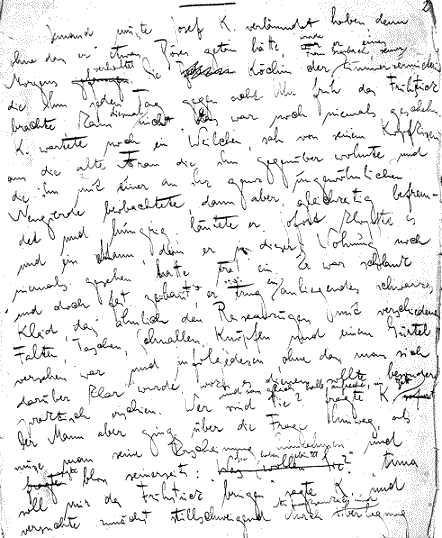Die Bescherung fand, weil auf das Klavier nicht verzichtet werden konnte, im Nebenzimmer statt. Das heißt, Josef und Johann hatten erst Zutritt, als der Vater am Klavier Stille Nacht, heilige Nacht spielte. Der Einzug ins Nebenzimmer geschah durch zwei Türen: von der Wirtschaft her zogen, ihre Gläser in der Hand, die vier letzten Gäste hinter Elsa herein. Hanse Luis, der Schulze Max, Dulle und Herr Seehahn. Durch die Tür vom Hausgang her zogen Josef, Johann, Niklaus und der Großvater ein. Zuletzt Mina, die Prinzessin und die Mutter, sie kamen aus der Küche.
Immer an Weihnachten trug Herr Seehahn am grünen Revers seiner gelblichen Trachtenjacke den Päpstlichen Hausorden, den er bekommen hatte, weil er als Marinerevolutionär in München zum päpstlichen Nuntius, den er hätte gefangen nehmen sollen, gesagt hatte: Eminenz, wenn Sie mit mir kommen, sind Sie verhaftet, wenn Sie die Hintertür nehmen, sind Sie mir entkommen.
Dulle war wohl von allen am weitesten von seiner Heimat entfernt. Dulle war aus einem Ort, dessen Name in Johanns Ohren immer klang, als wolle man sich über Dulle lustig machen. Niemals hätte Johann in Dulles Gegenwart diesen Namen auszusprechen gewagt. Buxtehude. Dulle sprach anders als jeder andere im Dorf. Er hauste in einem Verschlag bei Frau Siegel, droben in Hochsträß, direkt an der frisch geteerten Landstraße. Dulle war Tag und Nacht unterwegs. Als Fischerknecht und als Durstiger. Oder hinter Fräulein Agnes’ Katzen her. Adolf behauptete, Dulles Verschlag, Wände und Decke, sei tapeziert mit Geldscheinen aus der Inflation. Hunderttausenderscheine, Scheine für Millionen, Milliarden, Billionen. Eine Zeitung habe, sagte Adolf, 1923 sechzehn Milliarden Mark gekostet. Immer wenn Johann von dieser Inflation etwas hörte, dachte er, das Land hat Fieber gehabt damals, 41 oder 42 Grad Fieber müssen das gewesen sein.
Der Schulte Max war nirgendwo her beziehungsweise überall her, eben vom Zirkus. Er nächtigte im Dachboden des von zugezogenen Fischerfamilien bewohnten Gemeindehauses, und zwar auf einem Lager aus alten Netzen.
Verglichen mit den Schlafstätten von Dulle und Schulze Max, war das, was Niklaus droben im Dachboden als Schlafstatt hatte, eine tolle Bleibe. Niklaus hatte ein richtiges Bett so mit alten Schränken umstellt, daß eine Art Zimmer entstand. Niklaus war für Johann interessant geworden, als Johann ihm einmal zugeschaut hatte, wie er seine Fußlappen über und um seine Füße schlug und dann in seine Schnürstiefel schlüpfte. Die Socken, die Mina ein Jahr zuvor für Niklaus gestrickt und unter den Tannenbaum gelegt hatte, hatte er einfach liegen lassen. Als Mina sie ihm in die Hand drückten wollte, hatte er den Kopf geschüttelt. Niklaus sprach selten. Mit Nicken, Kopfschütteln und Handbewegungen konnte er, was er sagen wollte, sagen. Wenn er meldete, daß Freifrau Ereolina von Molkenbuer drei Zentner Schwelkoks und Fräulein Hoppe-Seyler zwei Zentner Anthrazit bestellt hatten, merkte man, daß er keinerlei Sprachfehler hatte. Er sprach nicht gern. Sprechen war nicht seine Sache.
Unterm Christbaum lagen für Josef und Johann hellgraue Norwegerpullover, fast weiß und doch nicht weiß, silbergrau eigentlich. Mit graublauen, ein bißchen erhabenen Streifen. Aber auf der Brust zwei sehr verschiedene Muster, eine Verwechslung war zum Glück ausgeschlossen. Josef zog seinen sofort an. Johann hätte seinen lieber unterm Christbaum gesehen, aber weil alle sagten, er solle seinen doch auch probieren, zog er ihn an. Johann mußte, als er spürte, wie ihn dieser Pullover faßte, schnell hinaus, so tun, als müsse er auf den Abort, aber er mußte vor den Spiegel der Garderobe im Hausgang, er mußte sich sehen. Und er sah sich, silbergrau, fast bläulich erhabene Streifen, auf der Brust in einem Kreis ein Wappen. Königssohn, dachte er. Als er wieder hineinging, konnte er nicht ganz verbergen, wie er sich fühlte. Mina merkte es. Der steht dir aber, sagte sie.
Dieser Pullover waren aus dem Allgäu gekommen, von Anselm, dem Vetter genannten Großonkel.
Zu jedem Geschenk gehörte ein Suppenteller voller Plätzchen, Butter-S, Elisen, Lebkuchen, Springerle, Zimtsterne, Spitzbuben, Makronen.
Die Mutter sagte zu Mina hin und meinte die Plätzchen: Ich könnt ’s nicht. Johann nickte heftig, bis Mina bemerkte, daß er heftig nickte. Er hatte letztes Jahr von Adolfs Plätzchenteller probieren dürfen. Bruggers Plätzchen schmeckten alle gleich, von Minas Plätzchen hatte jede Sorte einen ganz eigenen Geschmack, und doch schmeckten alle zusammen so, wie nur Minas Plätzchen schmecken konnten. In diesem Jahr lag neben Johanns und Josefs Teller etwas in Silberpapier eingewickeltes Längliches, und aus dem Silberpapier ragte ein Fähnchen, darauf war ein rotes Herz gemalt und hinter dem Herz stand –lich. Über dem Herz stand: Die Prinzessin grüßt. Josef probierte schon, als Johann noch am Auspacken war. Nougat, sagte er. Richtig, sagte die Prinzessin. Toll, sagte Josef. Johann wickelte seine Nougatstange unangebissen wieder ein.
Für Mina und Elsa gab es Seidenstrümpfe. Beide sagten, daß das doch nicht nötig gewesen wäre. Für Mina lag noch ein Sparbuch dabei. Mit einem kleinen Samen, sagte die Mutter. Bei der Bezirkssparkasse. Die gehe nicht kaputt. Mina sagte kopfschüttelnd: O Frau, vergelt ’s Gott! Für die Prinzessin lagen mehrere Wollstränge in Blau unter dem Baum. Sie nahm sie an sich, salutierte wie ein nachlässiger Soldat mit dem Zeigefinger von der Schläfe weg und sagte: Richtig. Und zu Johann hin: Du weißt, was dir bevorsteht. Johann sagte auch: Richtig! Und grüßte zurück, wie sie gegrüßt hatte. Er mußte immer abends die Hände in die Wollstränge stecken, die die Prinzessin dann, damit sie nachher stricken konnte, zum Knäuel aufwickelte. In jeder feien Minute strickte sie für ihren Moritz, den sie einmal im Monat in Ravensburg besuchen durfte; aber allein sein durfte sie nicht mit dem Einjährigen. Die Mutter des Siebzehnjährigen, der der Kindsvater war, saß dabei, solange die Prinzessin da war. Nach jedem Besuch erzählte die Prinzessin, wie die Mutter des Kindsvaters, die selber noch keine vierzig sei, sie keine Sekunde aus den Augen lasse, wenn sie ihren kleinen Moritz an sich drückte. Die Prinzessin, hieß es, sei einunddreißig. Sie hatte jedem etwas neben den Teller gelegt, und jedesmal hatte sie ihr Herz-Fähnchen dazugesteckt. Für Elsa eine weiße Leinenserviette, in die die Prinzessin mit rotem Garn ein sich aufbäumendes Pferd gestickt hatte. Für Mina zwei Topflappen, in einem ein großes rotes A, im anderen ein ebenso großes M. Für Niklaus hatte sie an zwei Fußlappen schöne Ränder gehäkelt. Für Herrn Seehahn gab es ein winziges Fläschchen Eierlikör. Für die Mutter einen Steckkamm. Für den Vater ein Säckchen mit Lavendelblüten. Für den Großvater ein elfenbeinernes Schnupftabakdöschen. Johann, sagte sie, geh, bring ’s dem Großvater und sag ihm, Ludwig der Zweite, habe es dem Urgroßvater der Prinzessin geschenkt, weil der den König, als er sich bei der Jagd in den Kerschenbaumschen Wäldern den Fuß verstaucht hatte, selber auf dem Rücken bis ins Schloß getragen hat. Alle klatschten, die Prinzessin, die heute einen wild geschminkten Mund hatte, verneigte sich nach allen Seiten. Johann hätte am liebsten nur noch die Prinzessin angeschaut. Dieser riesige Mund paßte so gut unter das verrutschte Glasauge. Für Niklaus lagen wieder ein Paar Socken und ein Päckchen Stumpen unterm Baum. Die Socken, es waren die vom vorigen Jahr, ließ er auch diesmal liegen. Die Stumpen, den Teller voller Plätzchen und die umhäkelten Fußlappen trug er zu seinem Platz. Im Vorbeigehen sagte er zur Prinzessin hin: Du bist so eine. Sie salutierte und sagte: Richtig. Dann ging er noch einmal zurück, zum Vater hin, zur Mutter hin und bedankte sich mit einem Händedruck. Aber er schaute beim Händedruck weder den Vater noch die Mutter an. Schon als er seine Rechte, der der Daumen fehlte, hinreichte, sah er weg. Ja, er drehte sich fast weg, reichte die Hand zur Seite hin, fast schon nach hinten. Und das nicht aus Nachlässigkeit, das sah man. Er wollte denen, die ihn beschenkt hatten, nicht in die Augen sehen müssen. Niklaus setzte sich wieder zu seinem Glas Bier. Nur an Weihnachten, an Ostern und am Nikolaustag trank er das Bier aus dem Glas, sonst aus der Flasche. Johann sah und hörte gern zu, wenn Niklaus die Flasche steil auf der Unterlippe ansetzte und mit einem seufzenden Geräusch leertrank. Wie uninteressant war dagegen das Trinken aus dem Glas. Niklaus setzte auch jede Flasche, die angeblich leer aus dem Lokal zurückkam und hinter dem Haus im Bierständer auf das Brauereiauto wartete, noch einmal auf seinen Mund; er wollte nichts verkommen lassen.
…
Der Vater ging zum Tannenbaum und holte ein blaues Päckchen, golden verschnürt, gab es der Mutter. Sie schüttelte den Kopf, er sagte: Jetzt mach ’s doch zuerst einmal auf. Eine indische Seife kam heraus. Und Ohrringe, große, schwarz glänzende Tropfen. Sie schüttelte wieder den Kopf, wenn auch langsamer als vorher. Für den Großvater lag ein Nachthemd unter dem Baum. Er sagte zu Johann, der es ihm bringen wollte: Laß es nur liegen. Als letzter packte der Vater sein Geschenk aus. Lederne Fingerhandschuhe, Glacéhandschuhe, sagte der Vater. Damit könnte man fast Klavier spielen, sagte er zu Josef. Und zog sie an und ging ans Klavier und ließ schnell eine Musikmischung aus Weihnachtsliedern aufrauschen. Hanse Luis klatschte Beifall mit gebogenen Händen; das war, weil er seine verkrümmten Handflächen nicht gegen einander schlagen konnte, ein lautloser Beifall. Er sagte: Was ischt da dagege dia Musi vu wittr her. Er konnte sich darauf verlassen, daß jeder im Nebenzimmer wußte, Radio hieß bei Hanse Luis Musik von weiter her. Dann stand er auf und sagte, bevor er hier auch noch in eine Bescherung verwickelt werde, gehe er lieber. Es schneie immer noch, er solle bloß Obacht geben, daß er nicht noch falle, sagte die Mutter. Kui Sorg, Augusta, sagte er, an guate Stolperer fallt it glei. Er legte einen gebogenen Zeigefinger an sein grünes, randloses, nach oben eng zulaufendes Jägerhütchen, das er nie und nirgends abnahm, knickte sogar ein bißchen tänzerisch ein und ging. Unter der Tür drehte er sich noch einmal um, hob die Hand und sagte, er habe bloß Angst, er sei, wenn es jetzt Mode werde, statt Grüßgott zu sagen, die Hand hinauszustrecken, dumm dran, weil er so krumme Pratzen habe, daß es aussehe wie die Faust von denen, die Heil Moskau schrieen. Und dann in seiner Art Hochdeutsch: Ich sehe Kalamitäten voraus, Volksgenossen. Und wieder in seiner Sprache: Der sell hot g’seet: No it hudla, wenn ’s a ’s Sterbe goht. Und mit Gutnacht miteinand war er draußen, bevor ihm die Prinzessin, was er gesagt hatte, in Hochdeutsch zurückgeben konnte. Elsa rannte ihm nach, um ihm die Haustür aufzuschließen. Dann hörte man sie schrill schreien: Nicht, Luis … jetzt komm, Luis, laß doch, Luiiiis! Als sie zurückkam, lachte sie. Der hat sie einreiben wollen. Johann staunte. Daß Adolf, Paul, Ludwig, Guido, der eine Helmut und der andere und er selber die Mädchen mit Schnee einrieben, sobald Schnee gefallen war, war klar; nichts schöner, als Irmgard, Trudl oder Gretel in den Schnee zu legen und ihnen eine Hand voll Schnee im Gesicht zu zerreiben. Die Mädchen gaben dann Töne von sich wie sonst nie. Aber daß man so eine Riesige wie Elsa auch einreiben konnte! Hanse Luis war einen Kopf kleiner als Elsa. Kaum war Elsa da, erschien Hanse Luis noch einmal in der Tür und sagte: Dr sell hot g’sell, a Wieb schla, isch kui Kunscht, abe a Wieb it schla, desch a Kunscht. Und tänzelte auf seine Art und war fort. Die Prinzessin schrie ihm schrill, wie gequält nach: Ein Weib schlagen, ist keine Kunst, aber ein Weib nicht schlagen, das ist eine Kunst. Der Dulle hob sein Glas und sagte, Ohne dir, Prinzessin, tät ich mir hier im Ausland fühlen.
…
Die Bescherung war vorbei, jetzt also die Lieder. Schon nach dem ersten Lied, Oh du fröhliche, oh du selige, sagte der Schulze Max zur Mutter, die beiden Buben könnten auftreten. Der Vater hatte die Glacéhandschuhe wieder ausgezogen und spielte immer aufwendigere Begleitungen. Nach Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frau’n sagte der Schulte Max zu Dulle: Auf diese Musikanten trinken wir noch ein Glas. Wenn du einverstanden bist. Dulle nickte heftig. Dann gehen wir aber, sagte der Schulze Max. Dulle nickte wieder. Wieder heftig. Der Schulze Max: Wir wollen überhaupt nicht anwachsen hier. Dulle schüttelte den Kopf ganz heftig. Der Schulze Max: Heute schon gar nicht, stimmt ’s? Dulle nickte so heftig, daß er danach seine Brille wieder an ihren Platz hinaufschieben mußte. Der Schulze Max: Auch eine Wirtsfamilie will einmal unter sich sein, stimmt ’s? Dulle nickte wieder, hielt aber, damit er heftig genug nicken konnte, schon während des Nickens die Brille fest. Der Schulze Max: Und wann möchte, ja, wann muß eine Familie ganz unter sich sein, wenn nicht am Heiligen Abend, stimmt ’s? Dulle nahm, daß er noch heftiger als zuvor nicken konnte, seine Brille ab. Der Schulze Max: Und was haben wir heute? Dulle, mit einer unglaublich zarten, fast nur noch hauchenden Stimme: Heilichabend. Der Schulze Max, sehr ernst: Daraus ergibt sich, sehr, sehr verehrte Frau Wirtin, daß das nächste Glas wirklich das letzte ist, das letzte sein muß.
aus: Martin Walser: Ein springender Brunnen (suhrkamp taschenbuch 3100 – 1. Auflage 2000 – S. 92- 96, S. 98-101)
(suhrkamp taschenbuch 3100 – 1. Auflage 2000 – S. 92- 96, S. 98-101)