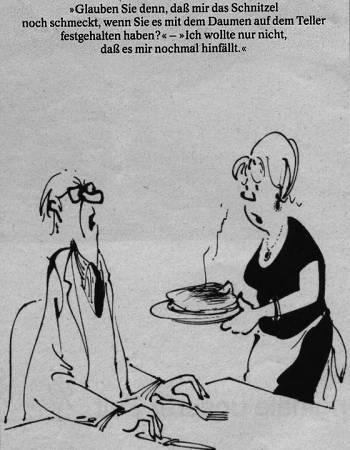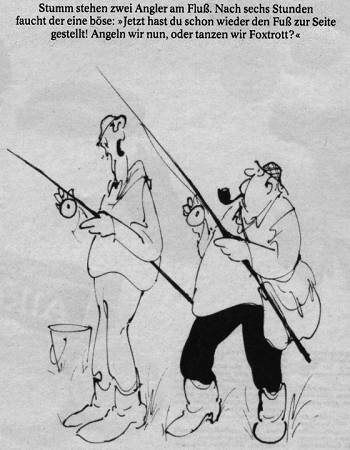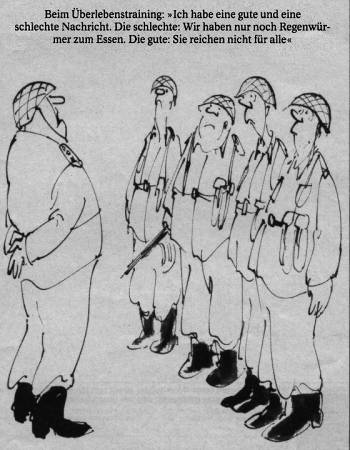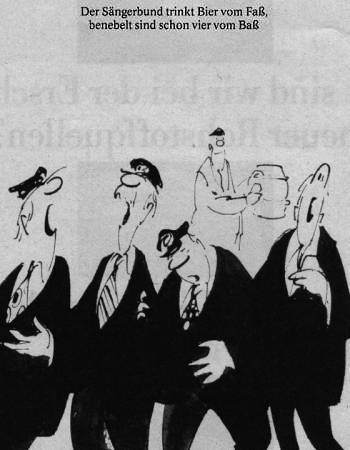Fortsetzung von: (13): Ein Spiel mit doppelten Böden
In der Kolumne „Der Witzableiter“ von Eike Christian Hirsch, die 1984 im ZEITmagazin erschien, geht es heute im 14. Teil um Auslassungen, also um fehlende Teile, die intuitiv ergänzt werden müssen, um einen Witz zu verstehen. Mancher ist dabei schon auf der Strecke geblieben, weil er die Pointe verpasst hat.
Müller geht an Krücken. „Verkehrsunfall“, sagt er. „Schrecklich!“ ruft sein Kollege aus, „ohne Krücken können Sie nicht gehen?“ „Weiß nicht“, sagt Müller, „mein Arzt sagt ja, mein Anwalt nein.“ Das ist nicht ganz leicht zu verstehen. Leider sind diesmal Witze dran, die einen ganzen Gedankengang auslassen.
Eine auffallend attraktive Frau kauft in einer Pariser Parfümerie ein Eau de Toilette und bezahlt mit einem Fünfhundert-Franc-Schein. „Bedauere“, sagt die Dame an der Kasse, „der Schein ist nicht echt.“ „Dann hat man mich“, sagt die Frau, „eben vergewaltigt.“ Ein bißchen Lebenserfahrung gehört wohl zum Verstehen dieser Witze dazu. Schließlich muß der Witzhörer die Auslassung mit eigenen Kenntnissen überbrücken. „Wünschen die Herrschaften noch etwas?“ fragt der Hoteldiener, nachdem er das Gepäck des Paares abgesetzt hat. „Danke, nein“, sagt der Mann. „Vielleicht noch etwas für die Frau Gemahlin?“ „Ach ja, das ist eine Idee“, sagt der Mann, „bringen Sie mir eine Postkarte.“
Der Soziologe Helmuth Plessner hat diese Technik als „witzige Prägnanz“ bezeichnet, die einen ganzen Gedankengang übergeht und zu „einer verschwiegenen Mehrdeutigkeit“ führt. Als Beispiel zitierte er selbst den Stoßseufzer eines Berliner Zoobesuchers angesichts einer Giraffe: „So ’n Hals und denn ’n Kümmel!“ Diese Auslassung kann man wohl deshalb recht leicht verstehen, weil es sich um einen Einfall aus den Tiefen des Gemüts handelt.
Verschlüsselter ist schon ein Ausspruch, den Sigmund Freud als Beispiel für eine Auslassung zitiert. Sie stammt aus der Festschrift eines Wiener Künstlerballes. Auf Hochdeutsch etwa: „Eine Frau ist wie ein Regenschirm. Man nimmt dann doch die Droschke.“ Das muß ich wohl erläutern. Es fehlt der Zwischensatz „wenn es regnet“ und am Schluß die Gleichsetzung Droschke/Dirne. Das ist Doppelsinn aus der Zeit der doppelten Moral. Uns kommt es heute zu rätselhaft vor.
„Warum bist du eigentlich nie Soldat gewesen?“ „Keine Ahnung. Dabei habe ich bei jeder Musterung mit dem Stabsarzt sogar um tausend Mark gewettet, daß ich tauglich bin. Aber immer vergeblich.“ Hier spürt man, finde ich, deutlich die Verwandtschaft von Witz und Rätsel. Als Rätsel würde der Gedanke wohl lauten: „Wie kann man eine Musterung mit Geld beeinflussen, ohne zu bestechen?“ Der Unterschied besteht darin, daß ein Rätsel die Einzelteile gibt und nicht das Ergebnis, während der Witz das Ergebnis (hier: Wette) gibt, aber uns ein fehlendes Teil intuitiv ergänzen läßt.
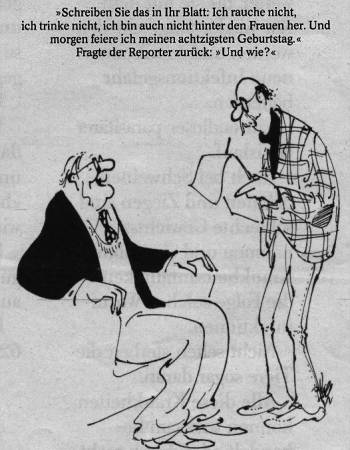
„Einer aus meiner Klasse“, erzählt der Sohn seinem Vater, „hat behauptet, ich sähe dir ähnlich.“ „So, so“, sagt der Vater, „und was hast du ihm geantwortet?“ „Nichts“, sagt der Sohn, „er ist stärker als ich.“ Das ist so ziemlich das Komplizierteste, was ein Witzhörer heute noch hinnimmt. Früher scheint das anders gewesen zu sein. Jean Paul zitiert 1804 eine Anekdote, deren Knappheit er besonders gelungen findet:
Ein römischer Kaiser fragte einen Fremden, über die Familienähnlichkeit spottend: „War deine Mutter nicht in Rom gewesen?“ – und dieser versetzte: „nie, aber wohl mein Vater.“ Heute ist dieser Witz schon deshalb unverständlich, weil man sich mit hochgestellten Herrschaften nicht mehr so auskennt. Es geht hier – wenn beide Männer Halbbrüder sind – um die Frage, wessen Mutter dann das uneheliche Kind hatte. Etwas verzwickt. Dennoch zitieren diesen Witz, leicht modernisiert, noch Sigmund Freud und Arthur Koestler als Vorbild für eine gelungene Auslassung.
„Ich habe mich gestern mit meinem Mann gestritten.“ „Und wer hat gewonnen?“ „Der Juwelier.“ Das ist doch wenigstens auf Anhieb zu begreifen, auch wenn hier ebenfalls viel ausgelassen worden ist. Aber das Ende ist bekannt („Der Juwelier“), und die Lücke schließen wir intuitiv.
Eine amerikanische Fluggesellschaft bot in einer Werbeaktion allen Ehefrauen an, ihre Männer auf Geschäftsreisen zu begleiten – zum halben Preis. Später wurden alle Frauen, die das Angebot genutzt hatten, schriftlich gefragt, wie ihnen die Reise gefallen habe. Die Antworten lauteten alle gleich: „Welche Reise?“
Es ist weniges so peinlich wie der Augenblick, da man zugeben muß, als einziger nicht mitlachen zu können, weil man die Pointe verpaßt hat. Beim Rätsel darf man scheitern, einen Witz aber muß man sofort mitkriegen, oder man hat verspielt. Man hat schon deshalb verspielt, weil man später nicht mehr lachen kann, wenn die Suche zu mühsam gewesen ist.
Hier blamiert sich hoffentlich nicht der geneigte Leser, sondern nur die dritte Dame, die unfreiwillig ein Geheimnis preisgibt: An einem heißen Sommertag gehen drei Damen in der Anlage ihres Tennisclubs spazieren. Plötzlich geraten sie an einen Mann, der nackt im Gras liegt und, um nicht erkannt zu werden, schnell sein Gesicht bedeckt. Da sagt die eine Dame: „Im ersten Moment dachte ich, es sei mein Mann, ist er aber nicht.“ „Das hätte ich dir gleich sagen können“, meint die zweite. Die dritte Dame sieht noch mal kurz hin und sagt dann: „Der ist überhaupt nicht aus unserem Tennisclub.“
Eike Christian Hirsch – Der Witzableiter (Kolumne in 25 Teilen)
aus: ZEITmagazin – Nr. 41/1984
[Fortsetzung folgt]